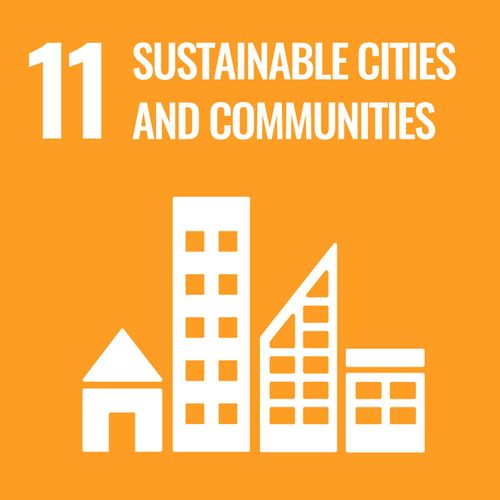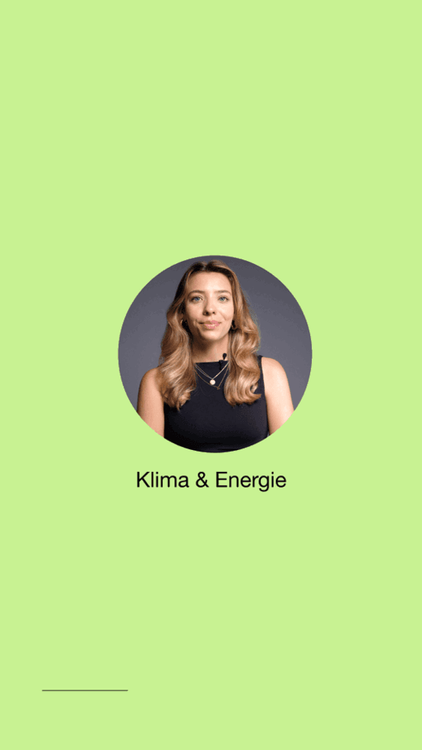Das extrem heftige Erdbeben vom 30. Juli vor der Küste von Kamtschatka mit einer Stärke von 8,8 rüttelte nicht nur Ortschaften auf der russischen Halbinsel durch und löste einen Tsunami im Pazifik aus. Die seismischen Erschütterungen hatten womöglich noch ganz andere Folgen.
Vier Tage später, am 3. August, brach der Vulkan Krascheninnikow aus. Der Feuerberg hatte zuvor 475 Jahre lang geschlafen. Auch andere Vulkane auf der Halbinsel, die schon vorher rumort hatten, zeigten teilweise neue Regungen. Der Kljutschewskoi zum Beispiel schickte Asche bis zu elf Kilometer hoch in den Himmel.
Insgesamt verzeichnet das Kamchatka Volcanic Eruption Response Team derzeit bei fünf Feuerbergen anhaltende Ausbrüche oder Ruhelosigkeit – das sind so viele wie lange nicht mehr.
Diese Häufung von Eruptionen kann ein ungewöhnlicher Zufall sein, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, die plausibel ist: Sehr starke Erdbeben könnten die Eruption nahe gelegener Vulkane auslösen, erläutert der Geologe Sebastian Watt von der University of Birmingham. Dafür gebe es eine Reihe historischer Beispiele, etwa aus Chile.
Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Vulkanausbrüchen sind vor allem dort zu finden, wo eine Erdplatte unter eine andere abtaucht: Seismologen sprechen von sogenannten Subduktionszonen. Solche Zonen gibt es nicht nur an der Küste von Chile, sondern auch in Japan, in Indonesien und an der Küste von Kamtschatka.
Es gibt mehrere mögliche Mechanismen
Erdbeben in Subduktionszonen könnten jedenfalls den Aufstieg von Magma und damit eine Eruption provozieren, erklärt Sebastian Watt. Doch wie genau die Erschütterungen einen Vulkan zum Ausbrechen bringen, welche Prozesse am Werk sind – das ist noch nicht klar.
Laut Forschern sind verschiedene Mechanismen denkbar. Die Vorgänge spielten sich im Mittel drei bis zehn Kilometer unter der Erde ab, sagt der Geophysiker Gilles Seropian von der University of Exeter. Darum sei es derzeit nicht möglich, sie direkt zu beobachten. Man könne nur Berechnungen anstellen, Experimente im Labor machen und austretende Lava oder Gase untersuchen.
Erdbeben verändern zum Beispiel die Druckverhältnisse rings um eine Magmakammer unter einem Vulkan. Das kann für das Magma einen Weg nach oben öffnen und auf diese Weise einen Ausbruch ermöglichen. Dieser Prozess ist schon gut belegt, für andere gilt das weniger.
Ein weiterer möglicher Mechanismus besteht darin, dass ein Beben den Druck in der Magmakammer senkt. Dadurch bilden sich mehr Gasblasen im Magma. Dieser Prozess erhöht den Druck in der Kammer wieder – und das kann dann zu einer Eruption führen. Das sei so ähnlich wie die Schaumbildung beim Öffnen einer Bierdose, sagt Seropian.
Die Erdbebenwellen können aber auch ein Schwappen des Magmas in der Kammer hervorrufen – jedenfalls wenn es dünnflüssig genug ist. Dies kann ebenfalls die Bildung von Gasbläschen bewirken. Laut Seropian wirkt beim Schütteln einer Champagnerflasche ein ganz ähnlicher Mechanismus.
Andere mögliche Mechanismen hängen mit hydrothermalen Systemen zusammen. Diese befinden sich im oberen Teil von Vulkanen – dort, wo Grundwasser zu Dampf erhitzt wird. Diese Systeme seien ganz besonders empfindlich gegenüber Erdstössen, erläutert der Geophysiker. In der Folge könnte es zu einer Kettenreaktion kommen, die letztlich zum Ausbruch eines Vulkans führe.
Hat das Erdbeben auf Kamtschatka nun die Eruption des Vulkans Krascheninnikow ausgelöst oder nicht? «Wir wissen es nicht sicher», sagt Seropian. «Aber es ist eine auffällige Abfolge, die man genauer untersuchen sollte.» In Zukunft werde man hoffentlich Beobachtungen machen können, die den einen oder anderen theoretisch denkbaren Mechanismus ausschliessen könnten, sagt er. Eine Kausalbeziehung zwischen einem Erdbeben und einer Eruption nachzuweisen, werde aber bis auf weiteres unmöglich bleiben.
Nicht jedes Megabeben bringt Vulkane zum Ausbruch
Für alle erwähnten Mechanismen gilt, dass nur Vulkane angeregt werden können, die sich bereits an der Schwelle zu einem Ausbruch befinden. Wenn es solche Vulkane gibt, können sie durch Megabeben wie bei Kamtschatka früher aktiv werden, als dies ohne ein Erdbeben der Fall gewesen wäre.
Diese Entwicklung muss nicht zwangsläufig eintreten. Nach dem extrem heftigen Erdbeben vor Sumatra im Jahr 2004 zum Beispiel, bekannt wegen des verheerenden Tsunamis im Indischen Ozean, kam es keineswegs zu einer Häufung von Ausbrüchen in der Region. Die indonesische Insel beherbergt zwar sehr viele Vulkane, doch offenbar war keiner von ihnen vor dem Beben in einem kritischen Zustand.
Die Ereignisse auf Kamtschatka deuten allerdings darauf hin, dass mindestens ein Feuerberg – der Krascheninnikow – eine Reaktion gezeigt hat. Laut Lehrmeinung kann der Effekt, den ein schweres Erdbeben auf Vulkane ausübt, bis zu fünf Jahre lang anhalten. Die vielen Nachbeben, die auch bei Kamtschatka zu beobachten sind, tragen womöglich zum Andauern der Nachwirkung bei. Womöglich kommen auf die russische Halbinsel also unruhige Zeiten zu.