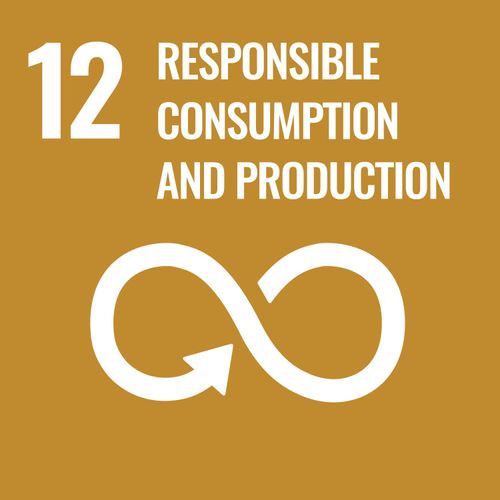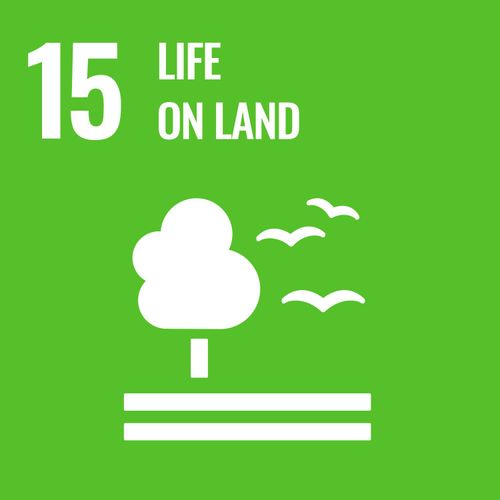Die Nachricht ist alarmierend: «Die Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten sind bedroht», konstatiert das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf seinem Internetportal. Der Zustand der Biodiversität in der Schweiz sei unbefriedigend – und noch schlechter als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die bisherigen Instrumente und Massnahmen hätten sich nach Einschätzung von Experten als «längst nicht ausreichend» erwiesen, trotz teilweiser Erfolge. «Der Verlust an Lebensräumen und Artenvielfalt sowie die Verschlechterung der Lebensraumqualität konnte nicht gestoppt werden», stellt das Bafu fest.
Die Aussagen der Berner Fachbehörde lesen sich wie ein Weckruf. So unterstreicht Bafu-Direktorin Katrin Schneeberger in einer 2023 erschienenen Infobroschüre, dass eine reichhaltige biologische Vielfalt kein Luxus sei, den man sich leisten mag oder nicht. «Sie ist die Grundlage unserer Ernährung, sie hilft, das Klima zu regulieren, reinigt Luft und Wasser, dient unserer Gesundheit und ermöglicht eine prosperierende Wirtschaft, kurz: Sie bildet eine wichtige Grundlage unserer Wohlfahrt.» Diese Basis beginne inzwischen aber zu bröckeln. «Die Qualität, Quantität und Vernetzung vieler Lebensräume reichen nicht mehr aus, um die Biodiversität unseres Landes langfristig zu erhalten», hält Schneeberger fest. Sie verweist auf die Roten Listen der gefährdeten Lebensräume: Demnach sind fast die Hälfte der 167 bewerteten Lebensraumtypen hierzulande bedroht.
Massnahmen nicht ausreichend
Die Politik ist angesichts solcher Zahlen auf nationaler und kantonaler Ebene keineswegs tatenlos geblieben. So wurde vom Bund 2017 ein «Aktionsplan Strategie Biodiversität» lanciert, der seither auch in vielfältigen Projekten umgesetzt wird. Ohne diese Anstrengungen wäre der Zustand der Biodiversität in der Schweiz nach Einschätzung von Experten vermutlich noch deutlich schlechter. «Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass die Pflege der Schutzgebiete, die Vernetzung von Lebensräumen und artspezifische Fördermassnahmen wirksam sind», so Katrin Schneeberger. «Die Biodiversitätsverluste konnten dadurch abgebremst werden. Solche Massnahmen reichen aber nicht aus, um den Trend umzukehren.»
Erforderlich ist laut Bafu ein umfassender Ansatz, der alle Bereiche der Gesellschaft einbezieht, so etwa die nachhaltige Produktion von Gütern und Dienstleistungen, insbesondere von Nahrungsmitteln. Dazu passt ins Bild, dass der ökologische Fussabdruck der Schweizer Bevölkerung im internationalen Vergleich noch immer überdurchschnittlich gross ist. Einer Bafu-Studie zufolge konsumiert heute jede hierzulande lebende Person im Schnitt 2,8-mal mehr Umweltleistungen und -ressourcen, als global gesehen pro Person noch verfügbar sind.
Breites Bündnis
Die Frage ist, welchen Kurs die Schweiz zum Erhalt der Biodiversität einschlagen soll. Reicht das bisher genutzte Instrumentarium, oder ist ein härteres Vorgehen angesagt? Die Meinungen gehen hier zum Teil weit auseinander. In wenigen Wochen, am 22. September 2024, werden die Stimmbürgerinnen und -bürger Gelegenheit haben, ihr Votum abzugeben: Zur Entscheidung steht die eidgenössische Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft» (Biodiversitätsinitiative). Vor fast vier Jahren mit 107'885 Unterschriften eingereicht, wird sie heute von einer breiten Koalition mit mehr als 50 Organisationen aus Landwirtschaft, Berggebieten, Fischerei, Gewässerschutz, Pärken sowie Naturschutz und Landschaftsschutz unterstützt. Ihre Forderungen zusammengefasst: Bund und Kantone sollen mit einem neuen Verfassungsartikel dazu verpflichtet werden, Natur, schutzwürdige Landschaften, Ortsbilder und Kulturdenkmäler besser zu schützen. Zudem soll die öffentliche Hand mehr Flächen und finanzielle Mittel für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität zur Verfügung stellen.
Gegenvorschlag abgelehnt
Bundesrat und Parlament gehen diese Forderungen zu weit. Sie haben sich daher nach langen Diskussionen gegen die Biodiversitätsinitiative ausgesprochen. Wie es heisst, würde mit Annahme der Initiative die nachhaltige Energie- und Lebensmittelproduktion stark eingeschränkt, ebenso die Nutzung des Waldes und des ländlichen Raums für den Tourismus. Die geforderte Erweiterung der Schutzflächen beschneide überdies die Kompetenzen und Handlungsspielräume der Kantone. Zudem würden auf die öffentliche Hand Mehrausgaben von 375 bis 440 Millionen Franken zukommen.
Ein Gegenvorschlag, zu dem die Initiantinnen und Initianten Hand geboten hatten, ist nicht zustande gekommen. Das wurde von vielen bedauert. Der Gegenvorschlag sah zunächst vor, den Anteil der Biodiversitäts- oder Schutzflächen in der Schweiz von 13 auf 17 Prozent zu erhöhen. Der Nationalrat strich diese Zahl dann in der Hoffnung, den Ständerat mit einer abgeschwächten Variante überzeugen zu können. Doch ohne Erfolg.
Höhere Preise befürchtet
Zur Allianz gegen die Biodiversitätsinitiative gehören unter anderem der Schweizer Bauernverband (SBV), die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, Wald Schweiz, der AEE Dachverband erneuerbarer Energien und der Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen sowie der Schweizerische Gewerbeverband. Die Biodiversitätsinitiative sei zu extrem und darum der falsche Weg, betont etwa der SBV. Er verweist darauf, dass die bäuerlichen Betriebe bereits heute viel für die Artenvielfalt machten. So liege der durchschnittliche Anteil der Biodiversitätsförderflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche bei 19,3 Prozent. Insgesamt geht es um mehr als 190 000 Hektar Land, was in etwa der Grösse der beiden Kantone Zürich und Zug entspricht. Statt noch mehr Flächen zugunsten der Artenvielfalt auszuweisen, solle zuerst das ökologische Potenzial der bestehenden Förderflächen optimal genutzt werden, heisst es. Wenn künftig weniger Flächen land- und forstwirtschaftlich genutzt werden dürften, verteuere sich zwangsläufig die Energie- und Lebensmittelproduktion. Dies führe zu mehr Importen.
In der Baubranche wiederum fürchtet man die Blockade zahlreicher Projekte, wenn bei einem Ja an der Urne auch der Schutz von Ortsbildern noch weiter ausgebaut werde. «Die Biodiversitätsinitiative verschärft die Gefahr eines Baustillstands massgeblich und gefährdet die notwendige Siedlungsentwicklung nach innen», warnt der Schweizerische Baumeisterverband.
Auswirkungen des Klimawandels
Geht es nach den Befürwortern, unternimmt die Schweiz hingegen noch viel zu wenig für den Umweltschutz und den Erhalt der Landschaften. Sie werfen in die Waagschale, dass eine intakte Natur vor Erosion und vor Überschwemmungen bei Starkregen schützt und als starke Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel anzusehen ist. Gerade deshalb verlangen die Initiantinnen und Initianten, dass künftig deutlich mehr Landesfläche für die Biodiversität zur Verfügung stehen soll – aktuell sehen sie nur 8 Prozent als ausreichend geschützt an.