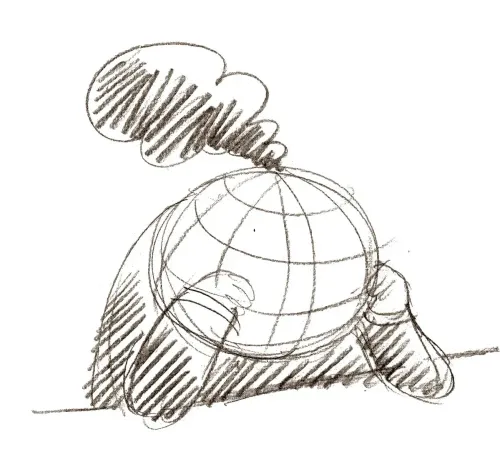Der Boden ist staubig. Am Himmel keine Wolke, die Regen bringt. Stattdessen strahlt die Sonne, Stunde um Stunde. Immer mehr Nadeln der Bäume werden braun.
Was Trockenheit ist, die dem Wald schadet, das glauben wir zu wissen: ein Boden, der trocken ist, weil es zu wenig geregnet hat. Es gibt aber auch eine andere Art von Trockenheit, die den Wald ebenfalls leiden lässt – und das ist die Trockenheit der Luft.
Je weniger Wasser die Luft gespeichert hat, desto mehr dürstet sie danach: Die trockene Luft übt gleichsam einen Sog aus – er zieht das Wasser aus den Nadeln und Blättern der Bäume heraus.
Im Pfynwald, tief unten im Rhonetal, unweit von Leuk im Wallis, untersuchen Forscher zurzeit, wie die Trockenheit von Boden und Luft die Waldkiefern schädigt: wie sie sich zum Beispiel auf ihren Stoffwechsel und die Tiefe der Wurzeln auswirkt. Am Ende wollen die Forscher den Forstleuten Tipps für die Zukunft geben. Denn der Klimawandel macht Dürren stärker und häufiger.
Die Bäume im Pfynwald werden schon lange untersucht
Der Pfynwald ist zwar kein Urwald, aber seit 1997 geschützt. Managementmassnahmen durch den Menschen sind untersagt. Das Biotop hat einiges hinter sich. In den 1970er Jahren führt die Luftverschmutzung durch die Industrie zu Baumschäden, bis Massnahmen zum Umweltschutz dem ein Ende setzen. Doch schon in den 1990er Jahren treten neuartige Baumschäden auf, viele Bäume sterben ab.
Zunächst weiss man nicht, ob die Schäden wieder von Umweltverschmutzung verursacht werden oder ob es an Trockenheit liegt. Seit 2003 beobachten Wissenschafter von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL den Wald darum mit Messinstrumenten. Sie weisen nach, dass die Bäume tatsächlich unter dem zunehmend trockenen Boden leiden.
Doch es gibt noch offene Fragen. Um sie zu klären, beginnt jetzt, im Jahr 2024, ein spezielles Projekt: Forscher wollen nämlich herausfinden, welche Rolle die stark zunehmende Lufttrockenheit im Vergleich zur Bodentrockenheit spielt. Marcus Schaub von der WSL und Charlotte Grossiord von der ETH Lausanne leiten das Projekt gemeinsam. Rund 800 Kiefern, die auf einer Hektare stehen, werden einbezogen. 130 Jahre alt sind die Bäume im Schnitt.
«VPDrought» haben die beteiligten Forscher das Projekt getauft. Das tönt komplizierter, als es ist. «Drought» bedeutet Dürre, und das Kürzel VPD steht für «vapor pressure deficit»: ein Fachbegriff für den Durst der trockenen Luft.
Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser kann sie theoretisch aufnehmen. Darum kann der Durst der Luft dann entsprechend grösser werden. Und genau das passiert auch. «Seit den 1980er Jahren hat das VPD im Frühling und im Sommer um rund 30 Prozent zugenommen», sagt der Geograf Stefan Hunziker von der WSL.
Wir stehen mit Hunziker mitten im Pfynwald auf einem Gerüst, das knapp über die Baumkronen hinausragt. Achtzig Düsen versprühen einen Nebel aus feinen Wassertröpfchen, welche sofort verdunsten.
Das Ziel, so Hunziker: Der Luftdurst (VPD) im Bereich der Baumkronen soll um 20 bis 30 Prozent verringert werden. Sensoren messen ständig, ob man den Zielwert erreicht, bei Bedarf werden weitere Wasserdüsen hinzugeschaltet. Im Maximum sprühen mehr als 200 um die Wette.
An anderen Messstellen im Pfynwald fehlen diese Wasserdüsen. Die Idee dahinter: Durch einen Vergleich von Bäumen mit und solchen ohne Luftbefeuchtung wollen die Forscher herausfinden, wie die Lufttrockenheit dem Wald schadet – und wie stark.
Ausserdem wird an manchen Stellen der Waldboden bewässert, an anderen wiederum wird ihm ein Teil des Niederschlags mithilfe von Plastikdächern vorenthalten. Auf diese Weise beziehen die Forscher auch die Bodentrockenheit in die Untersuchung ein.
Sensoren messen den Stammdurchmesser und den Saftfluss
Um die Reaktion der Bäume zu beobachten, haben die Forscher sie verkabelt und mit zahlreichen Sensoren bestückt, wie einen Patienten im Spital.
Ein Sensor misst zum Beispiel den Radius eines Baumstamms: Er erfasst, wie stark sich der Baumstamm ausdehnt und wieder zusammenzieht. Die Spanne beträgt bei einer Waldkiefer ungefähr zwei Zehntel Millimeter pro Tag. Die Schwankungen des Radius zeigen an, ob der Baum wächst und wie viel Feuchtigkeit sich gerade im Stamm befindet.
Ist die Luft heiss und trocken, verdunsten die Nadeln mehr Wasser, als die Wurzeln zeitgleich aufnehmen können. Der Wassermangel führt dazu, dass der Stamm zusammenschrumpft. Nachts, wenn genug Wasser im Boden ist, wird das Defizit wieder ausgeglichen. Während einer Dürre können Baumstämme aber tage- oder wochenlang schrumpfen.
Andere Sensoren erfassen den sogenannten Saftfluss – das ist der Aufwärtstransport von Flüssigkeit im Stamm. Der Ökophysiologe Roman Zweifel von der WSL demonstriert das Messprinzip an einem Holzmodell.
Roman Zweifel von der WSL misst den sogenannten Saftfluss mithilfe von Sensoren im Baumstamm. Bild: Sven Titz
Zwei Temperatursonden werden in den Stamm gebohrt, wobei die obere Sonde regelmässig Wärmepulse abgibt. Die sich ändernden Temperaturmuster, gemessen mit den beiden Sonden, erlauben, die Menge an transportiertem Wasser im Stamm zu berechnen.
Sensoren im Boden erfassen, wie viel Wasser für die Wurzeln noch verfügbar ist. Ist der Boden aber ausgetrocknet, wird es kritisch. Dann können Baumschäden auftreten, braune Nadeln zum Beispiel.
Aber aus welcher Tiefe kommt eigentlich das Wasser, das die Bäume aufsaugen? Diese Information liefern Instrumente zur Messung von Wasserstoff- und Sauerstoffisotopen. Wer sich der Stelle mit den Messgeräten nähert, dem fällt zunächst eine Schale mit Tischtennisbällen ins Auge.
Die Pingpong-Bälle haben einen praktischen Zweck. Bild: Sven Titz
Die Forscher spielen hier im Wald aber nicht Pingpong. Die Bälle hätten eine ganz praktische Funktion, erklärt der Ökologe Arthur Gessler von der WSL. Sie halten ein Kunststoffgewebe auf Abstand, das zur Vermeidung von Verschmutzung über die Schale gespannt ist.
Mit dieser Apparatur Marke Eigenbau fangen die Wissenschafter Regenwasser auf, in welchem sie die Konzentration der Isotope messen. Die gleichen Isotope registrieren die Forscher auch im Boden – in 10 Zentimetern, 20 Zentimetern und einem Meter Tiefe – sowie in der Baumrinde.
Da die Konzentration der Isotope im Regenwasser immer wieder schwankt, dient sie als eine Art Markierung des Wassers. An den Messdaten können die Forscher darum ablesen, in welcher Tiefe die Wurzeln das Wasser aufnehmen, das anschliessend im Baumstamm nach oben transportiert wird, und wie sich das mit zunehmender Trockenheit ändert.
Der Wald ist verkabelt. Bild: Sven Titz
Was die Forscher schon wissen: Bäume mit tieferen Wurzeln halten besser Trockenheit aus. Das ist grundsätzlich auch keine Überraschung, denn in der Tiefe ist der Boden oft noch länger feucht als in der Nähe der Oberfläche. Von daher könnte man annehmen, dass die Wurzeln vor allem unter Dürrebedingungen länger werden.
Der Ökologe Gessler erzählt aber, in der Vergangenheit habe sich das Gegenteil gezeigt: Nachdem es viel geregnet hatte, reichten die Wurzeln der Bäume weiter in die Tiefe.
Gibt es weniger Bäume, erhält der einzelne mehr Wasser
Das Projekt VPDrought hat gerade erst begonnen, bis 2028 soll es laufen. Aber durch die Beobachtung der Wurzeln zeichnet sich schon eine erste Idee ab, was man den Forstleuten raten könnte, die den Wald für die Zukunft fit machen wollen: Man kann den Wald zum Beispiel ausdünnen. Gibt es weniger Baumkronen, erreicht mehr Regenwasser die Wurzeln, und diese werden tiefer, was die Widerstandsfähigkeit der Bäume erhöht. Auch grosse Lufttrockenheit kann ihnen dann weniger anhaben.
Generell glauben die Forscher, dass die Reaktionsmechanismen der Waldkiefern auf andere Arten übertragbar sind. So können anschliessend auch Vegetationsmodelle verbessert werden, die zur Simulation des Waldes im Klimawandel dienen.
Der Pfynwald beginnt sich auch ohne den Eingriff des Menschen bereits zu verändern. Zwischen den Waldkiefern wachsen erste kleine Flaumeichen. Diese Bäume kommen mit der wachsenden Trockenheit besser zurecht als die Kiefern – auch mit der Trockenheit der Luft. Auf lange Sicht dürfte es darum ratsam sein, weitere Eichen im Pfynwald anzupflanzen.
Das könnte Sie auch interessieren
Klima & Energie
Brasilien will den Schutz des Regenwalds zum Geschäft machen
Klima & Energie
Eine neue Ära der Klimapolitik beginnt: weniger Ziele, mehr Umsetzung
Gesellschaft
Was die Luft über Artenvielfalt verrät