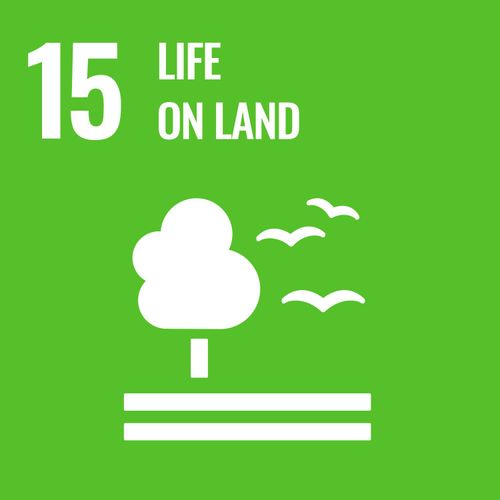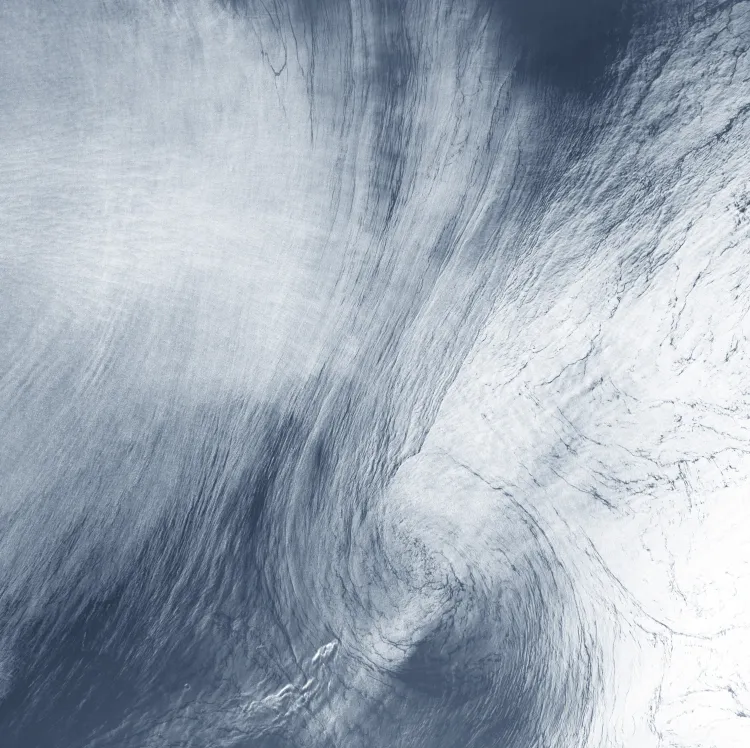Eine andere wichtige Frage ist die nach der Kommunikation. Oft geben die Forscher zwei Zahlen bekannt: wie stark sich die Wahrscheinlichkeit verändert hat, dass ein Wetterextrem eintritt, und wie stark sich dessen Intensität verändert hat – bei einer Hitzewelle zum Beispiel die Höchsttemperatur.
Gerade bei der Kommunikation der Wahrscheinlichkeit komme es immer wieder zu Missverständnissen, erläutert Douglas Maraun von der Universität Graz, der selbst schon an Attributionsstudien beteiligt war. «Wenn Laien hören, eine bestimmte Hitzewelle hätte es ohne den Klimawandel nicht gegeben, dann denken sie, es hätte überhaupt keine Hitzewelle gegeben.» Doch das stimme nicht. In Wirklichkeit wäre auch ohne Klimawandel eine Hitzewelle aufgetreten – bloss mit niedrigeren Temperaturen.
Im Zweifelsfall ist die Intensitätsänderung ohnehin die sinnvollere Information. Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit ergäben sich oft extreme Zahlen mit einer riesigen Fehlermarge, sagen mehrere Forscher übereinstimmend.
Klimamodelle haben Schwierigkeiten mit der Wetterdynamik
Event-Attribution wird oft mit einer Methode betrieben, die pauschale Aussagen zum Einfluss des Klimawandels erlaubt, etwa zur Wahrscheinlichkeit von Wetterextremen. Doch diese Methode hat einen Nachteil: Alle Veränderungen des Klimas werden in einen Topf geworfen.
Dabei ist der Klimawandel vielschichtig: Einerseits ist es schlicht wärmer geworden, andererseits haben sich dadurch auch die Luftströmungen verändert. Den Wandel der Luftströmungen können Klimamodelle aber oft noch nicht gut wiedergeben. Und das verzerrt in der Attributionsforschung dann die Resultate.
Davide Faranda, ein Fachmann für Wetterextreme vom Institut Pierre-Simon Laplace des französischen Forschungszentrums CNRS, gibt ein Beispiel: In Westeuropa sei es noch wärmer geworden als erwartet, und das hänge auch mit veränderten Luftströmungen über dem Nordatlantik zusammen. Wie sich diese Luftströmungen im Zuge des Klimawandels änderten, könnten die Modelle aber nicht reproduzieren. In der Folge unterschätzen sie, wie häufig extreme Hitzewellen in Westeuropa inzwischen auftreten können.
Der Blick für Details soll die Attribution besser machen
Klimaforscher haben darum vor einigen Jahren eine neue Methode ersonnen: den sogenannten Storyline-Ansatz. Das Ziel ist, die spezifischen Umstände herauszuarbeiten, die zu einem Wetterextrem geführt haben.
Das Tiefdruckgebiet «Boris» wurde zum Beispiel auch deshalb so stark, weil es sich so langsam bewegte und weil es mehrere Feuchtequellen in der Umgebung gab – unter anderem das warme Mittelmeer. Diese Faktoren trugen zu den heftigen Niederschlägen und zu den Überschwemmungen bei.
Solche Details sollten in Attributionsstudien in Zukunft stärker berücksichtigt werden, sagen Jacopo Riboldi und sein ETH-Kollege Robin Noyelle – sie haben die Vor- und Nachteile von Attributionsstudien anhand von Simulationsdaten analysiert. «Man liefert dann nicht nur eine Zahl, sondern lernt tatsächlich wissenschaftlich etwas dazu», sagt Noyelle.
Ein Wetterextrem wird innerhalb von 24 Stunden eingeordnet
Die Event-Attribution hat Schule gemacht. Fast jede Woche erscheint eine neue Studie. Diese Art der Forschung läuft mit dem gewohnten gemächlichen Tempo der akademischen Welt: Bis eine Arbeit veröffentlicht ist, dauert es Monate, wenn nicht Jahre.
Doch die Öffentlichkeit ist ungeduldig, sie will sofort Antworten haben. Im Idealfall schon dann, wenn das Wetterextrem noch im Gange ist. Zwei Forschergruppen – World Weather Attribution (WWA) und Climameter – versuchen sich darum seit ein paar Jahren in einer Art Expressvariante der Event-Attribution. Sie versprechen, innerhalb von wenigen Tagen die Rolle des Klimawandels einschätzen zu können.
Grundsätzlich ergänzen sich die beiden Gruppen: WWA schätzt ab, wie stark der Klimawandel als Ganzes ein Wetterextrem verändert hat, während Climameter mit dem Storyline-Ansatz vor allem untersucht, wie sich einzelne Aspekte des Wetterextrems verändert haben. «Es ist gut, mehrere Methoden miteinander vergleichen zu können», sagt Davide Faranda, der vorwiegend in der Gruppe Climameter mitwirkt.
Gelegentlich lösen die schnellen Attributionsstudien aber Skepsis aus. In manchen Berichten von WWA sei die Tendenz zur Übertreibung zu erkennen, sagt Robin Noyelle.
Wenn die Unsicherheit nicht in den Medien ankommt
Ein Beispiel für eine Attributionsstudie, die in die Kritik geriet, war der WWA-Bericht zu den Waldbränden von Los Angeles im Januar dieses Jahres. In einer Medienmitteilung verkündete die Forschergruppe, der Klimawandel habe Wetterlagen, die Brände begünstigten, um «ungefähr 35 Prozent» wahrscheinlicher gemacht.
Was in der Medienmitteilung nicht stand: Diese Prozentangabe war ziemlich unsicher. Die Klimamodelle lieferten der WWA-Gruppe zwar grundsätzlich ähnliche Resultate, aber die Spanne der möglichen Werte war recht gross. Diese Unsicherheit konnte aber nur erkennen, wer den Bericht las, der der Medienmitteilung zugrunde lag. Viele Medien gaben die Prozentzahl ohne Einordnung wieder und liessen das Wort «ungefähr» weg.
Sjoukje Philip vom staatlichen Wetterdienst der Niederlande, die in der WWA-Gruppe mitwirkt, erläutert auf Anfrage der NZZ, warum die Resultate zu den Waldbränden auf diese Weise kommuniziert worden sind. In den gemessenen Wetterdaten habe man einen sehr ähnlichen Trend gefunden wie in den Modellergebnissen. Wegen dieser Übereinstimmung habe sich die WWA-Gruppe entschlossen, nur eine einzige Zahl zu nennen.
Aus Erfahrung wisse man, dass die Kommunikation von Unsicherheit die Öffentlichkeit von der Botschaft ablenken könne, sagt Philip. Es sei immer ein Balanceakt: Würde die Unsicherheit zu stark betont, könnte dies den Eindruck vermitteln, dass man gar nichts aussagen könne.
Die Attribution dient auch Gerichtsprozessen
Längst hat die Event-Attribution Konsequenzen, die weit über die wissenschaftliche Neugier hinausreichen. Neuerdings werden die Ergebnisse sogar vor Gericht verwendet. Umweltorganisationen verklagten mehrere Firmen und Länder, weil diese mit ihren Emissionen zu Wetterextremen beigetragen hätten, und als Argumente führen sie Zahlen aus Attributionsstudien ins Feld.
Diese Verwendung der Forschungsergebnisse sei aber nicht ihr Antrieb für Event-Attribution, sagt Sjoukje Philip. Sie wolle vielmehr Menschen helfen, Wetterextreme besser zu verstehen und sich auf künftige Ereignisse vorzubereiten.