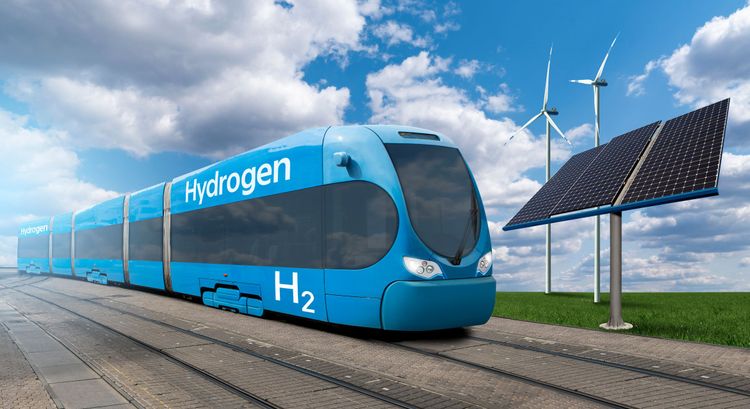Die Energiewende in der Schweiz gleicht einer Gratwanderung: Das Land muss seine CO₂-Emissionen drastisch senken und zugleich eine verlässliche Stromversorgung sicherstellen. Zwar stammten 2022 bereits knapp 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen, doch Sonnen- und Windenergie schwanken stark: Im Sommer gibt es einen Überschuss, im Winter droht ein Engpass. Ohne leistungsfähige Speicher geht wertvolle Energie verloren – und die Versorgungssicherheit gerät unter Druck.
Hier setzt eine von der ETH Zürich und der EPFL gegründete «Coalition for Green Energy and Storage» an: Sie bündelt Fachwissen aus Forschung, Politik und Wirtschaft, um Technologien für die langfristige Speicherung von erneuerbarer Energie zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Drei Projekte zeigen, wie vielfältig diese Ansätze sind – und welches Potenzial sie haben.
Wasserstoff verstromen
Auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich steht Wendelin Stark zwischen drei silbernen Stahlfässern – gross wie kleine Silos, verbunden durch Kabel und mit Alufolie umwickelte Rohre. «Wir haben den langweiligsten Reaktor der Welt gebaut», sagt der ETH-Professor und lacht. Doch die unscheinbare Anlage hat es in sich: Sie speichert Sonnenenergie – nicht in Batterien, sondern in Eisen.
Stark und sein Team haben dafür einen innovativen Prozess entwickelt: Strom wird im Sommer in Wasserstoff umgewandelt. Dieser reduziert in einer chemischen Reaktion Eisenoxid zu elementarem Eisen. Im Winter kehrt man den Prozess um – Wasserdampf reagiert mit dem Eisen, es entsteht erneut Wasserstoff, der sich dann verstromen oder verbrennen lässt. «Im vollgeladenen Zustand ist der Speicher einfach ein Fass voller Eisen», sagt Stark. Keine Explosionsgefahr, keine Hochdrucktanks – nur ein metallisches Pulver, das auf Temperatur gebracht werden muss.
Das Verfahren ist sicher, günstig und skalierbar – ideal für abgelegene Regionen oder energieautarke Quartiere. Noch allerdings ist es wenig effizient: Aufgrund der vielen Umwandlungsschritte bleibt am Ende nur rund ein Drittel der eingesetzten Energie als nutzbarer Strom übrig. Um das Verfahren zu optimieren, arbeiten Stark und sein Team auf dem Hönggerberg aktuell am Bau einer deutlich grösseren Pilotanlage. Sie soll bis 2026 in Betrieb gehen und im Winter ein Fünftel des Campus mit Strom versorgen.