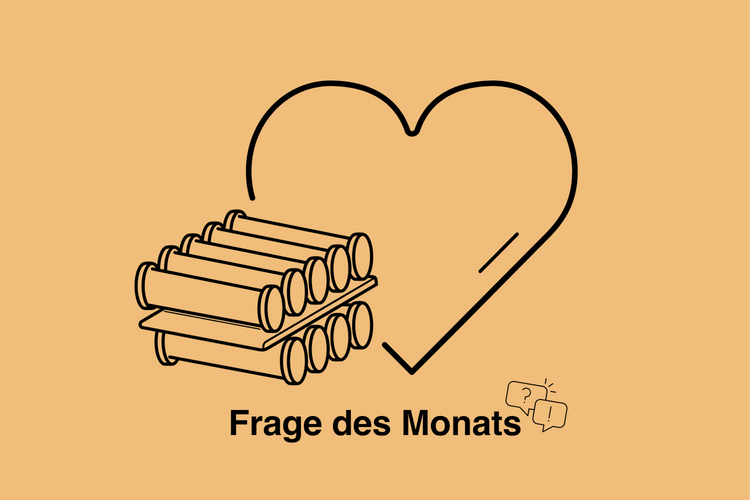Der nun 80-Jährige Architekt, Jan Störmer, hat zum ältesten Baumaterial der Welt zurückgefunden. Heute mache ihm das Bauen mit dem nachhaltigen Baustoff mehr Spass, sagt er. Was steckt hinter der Wiederentdeckung von Holz? Ein Gespräch mit Jan Störmer.
Beton ist heute als Klimasünder verschrien. Bei seiner Produktion entsteht sehr viel CO2. Politiker, Waldbesitzer, Wissenschafter und Umweltaktivisten – viele von ihnen werben seit einiger Zeit dafür, im Namen des Klimaschutzes auf Holz anstatt auf Stahl und Beton zu setzen. Auch Jan Störmer sagt, Holz sei als Material «phantastisch». Allein die Dämmung sei genial. Der Gebäudesektor ist für über 35 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich, klimafreundliche Lösungen müssen auch hier gefunden werden. Das wird umso dringlicher, als weltweit immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Es braucht neuen Wohnraum. Bauholz verursacht in seiner Herstellung weniger CO2. Holz bindet und speichert CO2 und entzieht es so – für einen gewissen Zeitraum wenigstens – der Atmosphäre.
Erst vergangene Woche schrieb das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer Mitteilung, dass bis zum Ende des Jahrhunderts Emissionen von mehr als 100 Milliarden Tonnen CO2 eingespart werden könnten, wenn die Mehrzahl der wachsenden Weltbevölkerung in Hochhäusern aus Holz wohnte. In die Sprache des Pariser Klimaabkommens übersetzt, entspräche dies etwa 10 Prozent dessen, was wir noch an CO2 ausstossen können, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten.
Aber auch hier schlummern Zielkonflikte. Für die Versorgung mit Bauholz in diesen Dimensionen würden neben natürlichen Wäldern auch grosse Mengen an neu angelegten Holzplantagen benötigt. Das beeinträchtige zwar nicht die Nahrungsmittelproduktion, könne aber zu einem Verlust der Artenvielfalt führen, sagen die Forscher.
Die Studie, deren Annahmen auch ihre Kritiker haben, zeigt, dass neben all dem Hype rund um die Holznutzung zunehmend auch unerwünschte und negative Auswirkungen ins Blickfeld geraten. Die Deutsche Umwelthilfe warnt auf Anfrage vor einem Überkonsum an Holz, weist auch auf den sich verschlechternden Zustand der Wälder nach Jahren der Trockenheit und Schädlingsbefall hin. Die Holzgewinnung müsse nachweislich nachhaltig sein.
Es bedürfe einer starken politischen Steuerung und einer sorgfältigen Planung, um sicherzustellen, dass Holzhäuser eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels spielten, sagen auch die Forscher des Potsdam-Instituts.
Politische Unterstützung braucht es gewiss. Das hat der Architekt Jan Störmer selbst erlebt. Deutschland hinke beim Bauen mit Holz hinterher, sagt er im Gespräch. In anderen Ländern würden schon heute Hochhäuser über 100 Meter geplant. Dazu gehört auch die Schweiz. Das Hamburger Holzhochhaus wird fast 70 Meter in die Höhe ragen. Das sogenannte «Roots»-Projekt soll in der Hafen-City auf 19 Stockwerken Wohnungen, Büros und Ausstellungsflächen beherbergen, schreibt der Hamburger Senat.
Höher bauen in Hamburg
Dass das höchste Holzgebäude Deutschlands dort stehen wird, war so eigentlich gar nicht geplant, sagt Störmer. Angefangen habe alles damit, dass sein Architekturbüro bei einem Wettbewerb für ein Holzhaus – kein Hochhaus – mitgemacht und nicht den ersten Preis gewonnen habe. Dafür fiel das Projekt der Hansestadt Hamburg auf, die im Preisgericht sass. Und so kam es, dass seit 2018 ein Holzhochhaus auf einem Grundstück in der Hafen-City geplant und gebaut wird.
Störmers Ziel: «Versuchen wir mal, den Anschluss an die internationale Entwicklung in Schweden, Österreich, Kanada zu finden», erinnert er sich im Gespräch. Hürden gab es schnell, in Form deutscher Gesetzmässigkeit: «Unsere Bauvorschriften sind einfach komplizierter und bürokratischer», sagt er. Da müsse sich dringend etwas ändern.
In diesem Fall habe die Bürokratie jedoch kooperiert und Ausnahmeregeln entwickelt, die eventuell in die Bauordnung eingeführt werden könnten, sagt Störmer. Ein Hochhaus mit brennbarem Tragwerk sei bauordnungsrechtlich nicht zulässig, erklärt eine Präsentation, die er über das Projekt zusammengestellt hat. Dabei sei der Brandschutz gar nicht das grösste Problem, sagt er im Gespräch, aber die Bedenken hielten sich hartnäckig.
Auch Hamburg liegt daran, mit diesem Projekt zu punkten. Der Senat unterstützt seit 2017 das Bauen mit Holz, unter anderem, weil durch den hohen Vorfertigungsgrad die Bauzeit erheblich verkürzt werden könne.
Derweil hatte Störmers Büro vier Jahre Zeit, zu planen und vorzubereiten. Eigentlich viel zu lang für ein Architektenbüro, sagt er selbst. Das Projekt sei eben mehr eine Forschungsarbeit gewesen, eines, das die Weichen stelle für mehr Holzbauten und die entsprechenden Anpassungen der Bauordnung. Inzwischen bewege sich in Deutschland einiges. Baden-Württemberg etwa habe seine Bauordnung angepasst, auch Berl in. «Es geht rapide voran», sagt Störmer.
Leichtes Holz zum Bauen
Besucht man heute die Baustelle, muss man sich nicht einmal wirklich anstrengen, um sich das fertige Gebäude vorzustellen. Das Holzskelett ist durch den Gerüstbau zu sehen. Geschossdecken aus Holz liegen aufeinandergestapelt auf der Baustelle. Hier wird kein geschnittenes, dickes Holz verwendet, wie man es von Fachwerkhäusern kennt. Stattdessen würden hochwertige Binder aus Brettschichtholz genutzt, sagt Störmer. Das sei eine ganz andere Art, wie man Holz statisch belastbar mache, ohne dass es zu Dehnung oder Schrumpfung kommen könne.
Leimbinder sind also ideal geeignet, um daraus grosse Tragwerke zu machen. «Die kannst du wie Beton millimetergenau schneiden. Das ist das Wichtige», sagt Störmer. Der Unterschied dabei sei, dass Holzplatten rezykliert werden könnten. Betonplatten könnten zwar zertrümmert, aber eigentlich nicht mehr wiederverwendet werden (auch wenn das in der Schweiz schon machbar ist).
Als Architekt hat Störmer jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Auf der Baustelle gehe es jetzt nur noch um die Montage, sagt er. Das Haus sei im Prinzip ein zusammengeschraubtes, geordnetes Materiallager, in dem Menschen wohnen könnten. Liftschächte oder Treppen dürfen nach deutschem Baurecht nur in Beton gebaut werden. Die Wände aber wurden in einzelne Holzbauelemente aufgelöst, die vorgefertigt werden. «Es ist alles industriell hergestellt, das ist der ganz grosse Unterschied zum konventionellen Bau.»
In der Zukunft, so Störmer, wird es immer mehr um Vorfertigung gehen. Um den CO2-Fussabdruck des Bausektors zu reduzieren, aber auch, weil es gar nicht mehr genügend Facharbeiter für wuselige Baustellen gebe. «Holzbau ist wie ein Autobau – er ist vorweg fix und fertig zu planen. Auf der Baustelle haben wir Architekten eigentlich schon gar nichts mehr zu suchen, weil alles fertig ist.» Der Bau in Hamburg würde im Vergleich zur konventionellen Bauweise 31 Prozent CO2 einsparen, heisst es in der Projektpräsentation.
Heute sei ein solches Holzhausprojekt noch teurer, aber nicht mehr lange, davon ist Störmer überzeugt. Mit der schnellen Vorfertigung würden auch die Kosteneinsparungen kommen, vor allem wenn man in die Masse gehe. Gleichzeitig gelte es das Holz nicht zu verschwenden. Die Devise müsse lauten: «So wenig, aber so sinnhaft.»
Mit dem Wald fängt es an
Das bringt uns zum Forst, also dem Ort, wo das Holz herkommt. Störmer stellt sich viele Fragen dazu: Was braucht es, um den Holzbau zukunftsfähig zu machen? Welche Bäume müssen es sein? Welche Arten sind resistent und können Trockenzeiten aushalten? Welche Bäume wachsen so schnell, dass sie wirtschaftlich auch wirklich in den Kreislauf kommen?
Störmer spricht darüber regelmässig mit Waldbesitzern und Förstern. Unter anderem mit Fried Bernstorff. Dem niedersächsischen Adligen gehört einer der grössten Waldbesitze in Norddeutschland. Er sagt auf Anfrage, Bauen mit Holz sei ein absolutes Zukunftsthema. Dabei seien der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit ein Problem für die Forstwirtschaft. Der entsprechende Umbau der Wälder aber finde schon statt, Wälder würden vielfältiger werden.
Dabei erwähnt Bernstorff eine Herausforderung, die «Planet A» schon einmal beleuchtet hat: Welche Baumarten werden in Zukunft gebraucht? Die Frage sei sehr wichtig, wenn auch schwierig, sagt er. Man habe es hierzu in Deutschland mit engen Denkkorsetten zu tun. Viele Umweltschützer beharren auf heimischen Baumarten. Sie warnen davor, schnell wachsende Nadelbäume zu fördern. Dabei gehe es laut Bernstorff darum, Bäume zu finden, die auch mit viel weniger Wasser zurechtkämen. Ein Beispiel sei die Douglasie. Sie ist ursprünglich in Nordamerika zu Hause. Oder die Weisstanne. Die Kiefer kommt auch besser mit weniger Wasser zurecht als die Fichte.
«Das Wichtigste ist, eine gesunde Mischung zu haben», sagt Bernstorff. Mischwälder seien auch besser geeignet, um die steigende Nachfrage zu stillen. Bäume wüchsen nämlich in solchen Wäldern schneller.
Auf den Mischwald und den Preis kommt es an
Während viele Aktivisten jahrelang schlecht auf die Douglasie anzusprechen waren, ist Störmer ein Fan. Sie sei eigentlich ein idealer Baum, auch wenn wohl noch zu teuer, weil es in Deutschland zu wenig davon gebe. Dabei brauchte es doch eigentlich billiges Holz für die verleimten Brettschichten, sagt er.
Die Buche sei zu schwer dafür, auch die Eiche. Kiefernholz, Tanne, Lärche – alle leichten Hölzer seien dagegen ideal zum Verleimen. «Der Markt fragt natürlich, wo kann ich die billigste Holzplatte kaufen», sagt Störmer. Aus wertvollem Holz könne man schöne Bohlen machen, Fussböden und Treppen, aber die seien nicht zum allgemeinen Bauen mit Holz da. «Da muss sich der Forst drauf einstellen.»
Störmer wird diese Entwicklung bald nur noch von der Seitenlinie beobachten. Er will sich vom Tagesgeschäft eines Architekten zurückziehen. In der Zwischenzeit setzt sein Büro verstärkt auf Holz. Rund 25 Jahre nachdem er sein erstes Holzhaus gebaut hat, sind es nun um die 40 Prozent der Bauprojekte, Hotels und Bürobauten etwa, an denen mit Holz gearbeitet wird, sagt er.
Wird also bald alles nur noch aus Holz gebaut werden?
Störmer sagt Nein. Die Zukunft verlaufe doch nie nur auf einem Weg. Der Stahlbau werde nicht aufhören. Im Brückenbau sei er nicht zu toppen. Auch die Zeit des Betons sei nicht vorbei. Es gebe kaum ein Fundament, wo Beton nicht gebraucht werde. «Man soll den Beton nur minimieren.»