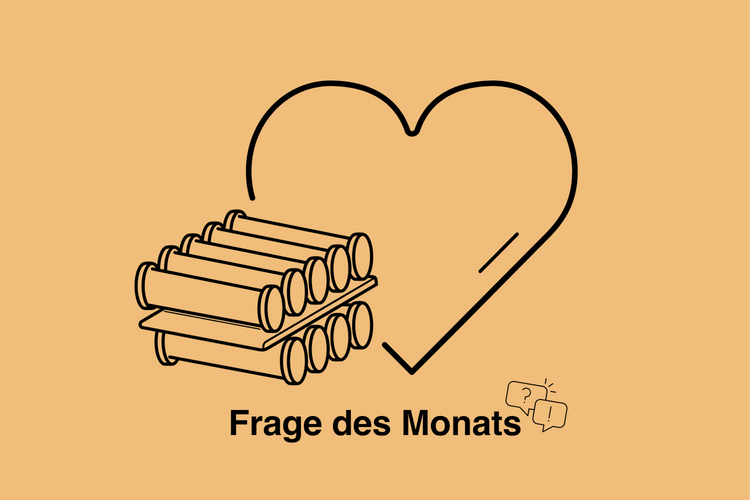Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens hat sich auch die Schweiz verpflichtet, bis 2050 nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre auszustossen, als ihr mit natürlichen oder technischen Methoden wieder entzogen werden können. Um dieses Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft zu erreichen, muss auf allen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ebenen angesetzt werden.
Zu den Schlüsselbranchen für mehr Nachhaltigkeit zählt die Bauwirtschaft. Diese war gemäss UNO-Umweltprogramm im Jahr 2015 für 38 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – weshalb sie zwingend einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz leisten muss. Wie Bernhard Salzmann, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV), erklärt, ist man sich dieser Verantwortung bewusst: «Haushalte brauchen viel Energie, sei es Strom, Gas oder andere Energieträger. Bei einem schlecht isolierten Gebäude wird durch den Verlust von Wärme mehr Energie verbraucht, was sich summiert.» Der Gebäudepark verursache hierzulande fast die Hälfte des Energiebedarfs sowie ein Viertel des gesamten CO2-Ausstosses.
Sanierungsrate unter 1 Prozent
«Dies bedeutet, dass die Modernisierung des Gebäudestands einer der wichtigsten Hebel ist, um die nationalen Klimaziele zu erreichen», sagt Salzmann. Gemäss dem SBV sind schätzungsweise 1,5 Millionen Gebäude aufgrund ihrer schlechten Energieeffizienz sanierungsbedürftig und müssten durch neue, klimaneutrale Ersatzbauten ersetzt oder – im Ausnahmefall – saniert werden.
Dies geschehe jedoch viel zu langsam: Die Sanierungsrate liege bei lediglich 0,9 Prozent. «Bei der derzeitigen Geschwindigkeit können die Klimaziele erst in 100 Jahren erreicht werden», ergänzt Salzmann. Um spätestens bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden, müsste die Sanierungsrate um das Dreifache erhöht werden. «Dies erreicht man unter anderem, indem Sanierungen von bestehenden Gebäuden gefördert oder ihre Ersatzbauten nicht behindert werden.» Analysen zeigten, dass mit Investitionen in den hiesigen Gebäudepark viel mehr bewirkt werden könne als beispielsweise mit Abgaben auf Flugtickets oder ähnlichen Massnahmen.
Aktuelle Zahlen belegen weiter: Ein heute gebautes Gebäude verbraucht vier- bis siebenmal weniger Energie als ein Gebäude, das vor 1980 errichtet wurde. Zudem emittieren Neubauten aufgrund geltender Gesetze kein CO2. Aus Sicht des Schweizerischen Baumeisterverbands ist es daher oft energieeffizienter, alte Bauten abzureissen und durch klimaneutrale zu ersetzen, als sie zu sanieren. Dies, obschon auch energetische Renovierungen unterstützt werden sollten.
Mehr Wohnraum für Städter
«Ersatzneubauten haben noch einen weiteren Vorteil: Sie nutzen den bebauten Raum besser aus», sagt SBV-Direktor Bernhard Salzmann. Derzeit werde jede abgerissene Wohnung in der Schweiz im Durchschnitt durch zwei neue ersetzt und der Wohnraum verdreifacht. Dies verhindere nicht nur die Zersiedelung der Landschaft, sondern schone auch die wertvolle Ressource Boden. Gleichzeitig schaffe man dort Wohnraum, wo die Bevölkerung ihn benötige, nämlich in den Städten und Agglomerationen.
Als gutes Vorbild nennt Salzmann die Stadt Zürich. Diese habe das Potenzial von Ersatzbauten erkannt. Zwischen 2011 und 2020 waren rund die Hälfte aller Neubauten Wohnungen, die als Ersatz für veraltete Wohnhäuser oder Siedlungen errichtet wurden. 40 Prozent der Wohnungen entstanden durch Umbauten, meist auf Industriebrachen. Gerade mal 10 Prozent aller Neubauten in Zürich wurden auf unbebauten Grundstücken errichtet, meist auf Lagerflächen, Parkplätzen oder Schrebergärten.
Auch in der Westschweiz werden bei der Planung von Bodenumnutzungen Bauten vorgeschlagen, die einerseits Konzepte für eine hohe Energieeffizienz beinhalten und andererseits eine Verdichtung des authentischen städtischen Raums ermöglichen. Beispiele hierfür sind Entwicklungsprojekte auf grossen Flächen wie Praille-Acacias-Vernets (PAV) in Genf, das in Zukunft Raum für rund 11 000 Wohneinheiten und ebenso viele Arbeitsplätze bieten soll.
Dies hat neben ökologischen auch soziale Vorteile: «Generell führt die Schaffung von neuem Wohnraum zu einer Entspannung der Preise für die Bevölkerung, die auf erschwingliche Wohnungen angewiesen ist», erklärt Salzmann. Doch auch für die Eigentümer seien Ersatzbauten interessant, weil sie zusätzlichen Wohnraum schaffen könnten, ohne bei ständig steigenden Quadratmeterpreisen neuen Baugrund erwerben zu müssen.
Abfall als wertvolle Ressource
Neben der Modernisierung des Gebäudeparks könnten weitere Massnahmen zu einer besseren Klimabilanz beitragen, beispielsweise im Bereich der Baumaterialien. Laut einer Schätzung des Bundesamts für Umwelt besteht der Gebäudebestand hierzulande aus 3,2 Milliarden Tonnen Kies, Sand und Zement. Dabei handelt es sich um die wichtigste einheimische Ressource. «Der schonende Umgang mit der immer knapper werdenden Ressource Boden ist ein Kernanliegen des Schweizerischen Baumeisterverbands und der gesamten Bauwirtschaft», sagt Salzmann. Heute würden bereits 75 Prozent des Aushubmaterials und 70 Prozent des Abbruchmaterials wiederverwendet. Dieses Vorgehen sei essenziell und ein wichtiges Puzzleteil im Kampf gegen die CO2-Emissionen.
Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist nicht neu, sondern geht bis ins Mittelalter zurück: Während einige Bauten Jahrhunderte überdauerten, wurden andere aufgegeben und die Materialien anderwärtig wiederverwendet. Bereits in den 1990er-Jahren begann die Bauwirtschaft, in Recyclinganlagen zu investieren. Gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) bleiben über 80 Prozent der Bauabfälle im Materialkreislauf. Dennoch ist das Potenzial noch riesig, wenn man bedenkt, dass die Branche schweizweit am meisten Abfall produziert (84 Prozent), weit mehr als der Haushaltkehricht (7 Prozent). Und von den 40 Millionen Tonnen Beton, die jedes Jahr verbaut werden, macht der wiederverwertete Beton gerade mal 15 Prozent aus.
Aus diesem Grund soll der Recyclinganteil weiter gesteigert werden. Unter anderem dank dem Einsatz von neuen Technologien wie robotergesteuerten Sortieranlagen. «Recycelte Materialien sind nicht von schlechterer Qualität», betont Salzmann. Der SBV appelliere insbesondere an die öffentlichen Bauherrinnen und Bauherren, eine Vorbildfunktion einzunehmen und mit recycelten Produkten zu arbeiten. Diesem Beispiel sollen in Zukunft auch Private folgen, um nachhaltigen Fortschritt zu sichern.