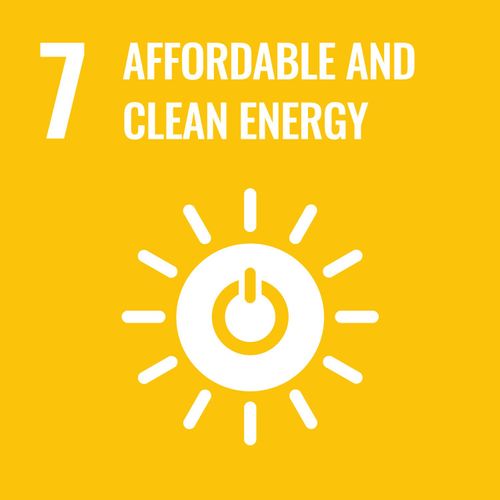Der Klimawandel ist keine politische Priorität mehr. Krieg und Sicherheitsfragen, Handelskonflikte und industriepolitischer Wettbewerb haben das Thema nach hinten verdrängt. Dazu kommt eine amerikanische Administration, die den klimapolitischen Konsens sprengen möchte.
Dieser Politik- und Sinneswandel lässt sich gut in der Energiebranche beobachten. Die Erdöl- und Gasunternehmen müssen sich nicht mehr verbiegen und ihre Botschaften in eine grüne Richtung zwängen. Shell und BP etwa sind zum fossilen Kerngeschäft zurückgekehrt. Sie haben die meisten Geschäftszweige im Bereich der erneuerbaren Energien aufgegeben oder stark reduziert.
Und dennoch können sie nicht ganz von den grünen Botschaften lassen – zumindest in Europa. In Mailand trifft sich zurzeit die internationale Gasbranche. Die grossen europäischen und amerikanischen Gasunternehmen sind da, ihre Pavillons auf dem Mailänder Messegelände sind ausgestattet mit grosszügigen Kaffeebars, gemütlichen Sitzecken und Topfpflanzen.
Die meisten Länderpavillons und Unternehmen werben zudem mit Schlagwörtern wie Nachhaltigkeit oder Naturnähe. Der amerikanische Gasriese ExxonMobil heisst seine Gäste vor einer rosa-grünen Blumenwand willkommen. Werbebanner des Unternehmens sprechen von emissionsarmen Technologien.
Ein Unternehmen nach dem anderen hebt hervor, wie «sauber», «nachhaltig», «grün», «emissionsarm» die jeweiligen Technologien seien, auch «Netto-Null bis 2050» lässt sich hier und da noch finden. Zumindest optisch unterscheidet sich das Messegelände damit kaum vom alljährlichen klimapolitischen Super-Event, den sogenannten COP.
Alles auf Gas
Die Stimmung ändert sich auf der Hauptbühne. Dort stellten sowohl CEO als auch Minister klar: Die Gasindustrie werde noch Jahrzehnte eine zentrale Rolle im europäischen Energiemix spielen – Energiewende und Klimaziele hin oder her. Auch Ditte Juul Jörgensen, eine der ranghöchsten Beamtinnen der EU-Kommission, unterstrich die langanhaltende Rolle für Erdgas in Europas Energiesystem. Die EU sei «offen für Geschäfte», sagte sie am Dienstag.
Es ist nicht von ungefähr, dass Jörgensen diese Botschaft in Anwesenheit des amerikanischen Innenministers Doug Burgum vermittelte. Der spürbare Aufwind der Gasindustrie hat viel damit zu tun, dass Donald Trumps Administration aggressiv den Export von Flüssigerdgas (LNG) forciert, unter anderem mit expliziten Klauseln in Handelsverträgen, die teilweise mit der Brechstange durchgesetzt wurden.
Burgum machte das in einer Rede auf der Konferenz deutlich. Freunde und Alliierte Amerikas kauften Energie aus den USA und nicht von Feinden. Im europäischen Kontext ist dieser Feind natürlich Russland. Die Botschaft an die europäischen Partner ist unmissverständlich: Kauft mehr Gas aus den USA. Das Handelsabkommen, das die EU kürzlich mit Donald Trumps Administration unterzeichnet hat, enthält dementsprechend auch die europäische Zusage, bis 2028 Erdöl, Gas und Atomenergie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen.
Skeptiker zweifeln an, dass diese Summe jemals erreicht werden kann. Auch in Mailand ging Burgum auf entsprechende Fragen nicht ein. Aber der Milliardenbetrag ist vor allem symbolisch. Die Verpflichtung soll zeigen, dass die Europäer nun auch in Energiefragen zu Amerikas Camp gehören, nach Jahrzehnten der Abhängigkeit von Russland.
Am Donnerstag trifft sein Kollege, der Energieminister Chris Wright, in Brüssel ein. Vor Journalisten in Mailand unterstrichen Burgum und Wright die amerikanische Mission. Sie wollen sicherstellen, dass die EU-Regularien keine Barrieren für den US-Export von fossilen Brennstoffen enthalten. Dazu gehören insbesondere störende Umwelt- und Klimaauflagen. Die Grenzwerte für Methanemissionen sind den Amerikanern dabei ein besonderer Dorn im Auge.
«Die Klimapolitik verhindert Innovationen durch Vorschriften, indem sie Brennstoffe und Technologien verbietet, die für die Welt heute wichtig sind», sagte Burgum am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die einzige Folge sei ein Anstieg der Preise.
Dabei muss die Energiepolitik laut Burgum und Wright vor allem ein Ziel verfolgen: günstige und zuverlässige Energie sicherstellen. Der europäische Plan, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, werde dagegen weder zu günstiger Energie noch zu Wachstum führen, sagte Wright am Mittwoch.
Die Klimapolitik der Europäer werde nicht einmal ernsthaft Emissionen reduzieren, stichelte er in Mailand. «Die Industrie verlässt Europa, und die gleichen Produkte werden jetzt in Asien produziert – mithilfe der Kohlekraft.»
Erneuerbare sind out, KI ist in
Die Administration von Donald Trump setzt neben den fossilen Brennstoffen auch auf die Atom- und die Wasserkraft. Damit, so Burgum und Wright, werde man sicherstellen, dass künftig genügend Strom zur Verfügung stehe, um die wirtschaftliche Zukunft der USA zu garantieren.
Donald Trumps Administration geht es vor allem um eines: Datenzentren und Künstliche Intelligenz. «Die derzeitige Bedrohung ist nicht der Klimawandel, sondern die Niederlage im Wettlauf um künstliche Intelligenz, weil wir nicht über die nötige Energie verfügen», sagte Burgum.
Solar- und Windenergie gehören nicht zu den Technologien, die von der Administration unterstützt werden. Im Gegenteil. Donald Trump wettert regelmässig gegen diese erneuerbaren Energien. Seine Administration hat Offshore-Windprojekte gestoppt und Subventionen für Wind- und Solarprojekte beendet.
Mit dieser Geldverschwendung sei nun Schluss, sagten sowohl Burgum und Wright auch in Mailand. Jahrzehntelang habe man diese Technologien gefördert, der Anteil am Energiemix sei heute dennoch noch viel zu klein, um die weitere Unterstützung zu rechtfertigen.
Diese Politik führt gemäss neuen Zahlen von Analysten der Rhodium Gruppe auch dazu, dass die Emissionen in den USA bis zum Jahr 2040 wohl weit langsamer fallen werden als noch unter der Vorgänger Administration erwartet worden war. Die Klimaziele, die Joe Biden noch versprochen hatte, werden so längst nicht erreicht werden.
Europäische Firmenchefs teilen diese Abneigung gegen die erneuerbaren Energien nicht. Claudio Descalzi, der CEO des italienischen Gasgiganten Eni, etwa unterstrich, man investiere nicht in erneuerbare Energien, weil es Mode sei, sondern, um sich zu diversifizieren. Descalzi sieht in den erneuerbaren und emissionsarmen Energiequellen ein Geschäft, das während der kommenden Jahren zunehmend mit den Einnahmen durch Erdöl und Gas werde konkurrieren können.
Auch Patrick Pouyanné, der CEO des französischen Energieriesen Total, ignorierte die Erneuerbaren nicht völlig in seiner Rede auf der Messe. Gas habe nicht nur eine glänzende Zukunft vor sich. Total werde auch davon profitieren, unter anderem weil es bei LNG-Anlagen in den USA beteiligt sei. Gleichzeitig werde man weiterhin in erneuerbare Energien investieren, allen voran Solar- und Windenergie an Land.
Sieht man von der Rhetorik der Administration ab, werden die erneuerbaren Energien auch in den USA weiterhin eine Rolle spielen. Das räumt auch der amerikanische Energieminister Wright ein. «Wir wollen, dass Solarenergie auf dem Markt konkurrieren kann», sagt Wright auf Nachfrage von NZZ. Solar werde in Zukunft eine Rolle spielen. Mehr noch, das Energieministerium investiere auch in Forschungsprojekte für die Entwicklung von Batterien und Langzeitspeichern.