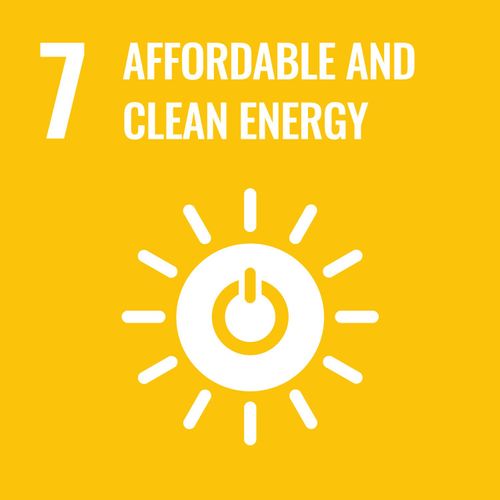Erdöl- und Gasunternehmen sind die idealen Feindbilder in der Klimapolitik. Das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ist schliesslich für mehr als 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Aktivisten und Forscher investieren deshalb viel Geld und Zeit, um das Ende der fossilen Brennstoffe herbeizuführen.
Jetzt zeigen neue Daten der Internationalen Energieagentur (IEA): Die Branche hat auch abseits der öffentlichen Debatte Probleme. Denn die bestehenden Öl- und Gasfelder geben Jahr für Jahr weniger her. Unternehmen müssen jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar investieren, um die Produktivität der Öl- und Gasfelder zu maximieren und Rückgänge wettzumachen.
Fast 90 Prozent der jährlichen Investitionen werden seit 2019 dafür verwendet. Dazu gehören beispielsweise zusätzliche Bohrungen in bestehenden Feldern, um mehr Öl und Gas zu gewinnen. Nur ein kleiner Teil der Gelder fliesst in die Erschliessung neuer Vorkommen.
Noch aber wächst die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas, auch wenn die IEA davon ausgeht, dass sie im Zuge der Energiewende ab 2030 langsam anfangen wird zu sinken. Erdgas war in den letzten zehn Jahren der am schnellsten wachsende fossile Brennstoff.
«Die Rückgänge bei der Förderung sind das grosse Tabuthema», sagt Fatih Birol, der Geschäftsführer der IEA. Dabei zeigt eine Analyse der Agentur, die diese Woche veröffentlicht wurde, dass sich der Rückgang in den vergangenen Jahren sogar beschleunigt hat. Denn Unternehmen seien heute stärker von Schiefervorkommen und Ressourcen im Meer abhängig, deren Förderung aufwendig sei, sagt die IEA. Die Studie stützt sich auf Produktionsdaten von rund 15 000 Öl- und Gasfeldern in aller Welt.
Die IEA gibt ein Beispiel, wie sich die Produktionsrückgänge auf den Markt auswirken könnten. Ohne Investitionen in bestehende Erdölfelder könnten jährlich Volumen in der Höhe der gesamten Produktion Brasiliens und Norwegens wegfallen. Brasilien macht rund 4 Prozent der globalen Produktion aus, Norwegen etwa 2 Prozent. Die Erdgasproduktion könnte laut den IEA-Berechnungen um eine Menge zurückgehen, die der heutigen Erdgasproduktion Afrikas entspricht.
Was eine rein technische Frage sein könnte, hat Auswirkungen auf die weltweite Energieversorgung und die Emissionen – und die Energiesicherheit Europas.
Neue und alte Abhängigkeit
Denn Europa ist trotz der Energiewende weiterhin stark abhängig von fossilen Brennstoffen. Heute macht ihr Anteil am Energiemix allein in der EU rund 70 Prozent aus, jener an der Stromerzeugung etwas über 30 Prozent.
Diese Abhängigkeit – und die Risiken, die damit verbunden sind – ist mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. 2021 bezog die EU noch über 40 Prozent ihrer Gaseinfuhren aus Russland, heute sind es weniger als 20 Prozent.
Diese Abhängigkeit erklärt auch, warum EU-Politiker die Klimapolitik zunehmend aus einer sicherheitspolitischen Perspektive zu vermarkten versuchen. Die Botschaft dabei: Die Energiewende, allen voran die Umstellung auf Solar- und Windenergie, helfe dabei, Energieimporte und Importkosten zu reduzieren und die Souveränität der EU zu stärken.
Europa fällt zurück
Der jüngste IEA-Bericht macht vor diesem Hintergrund deutlich, mit welchen politischen Konsequenzen die Förderung fossiler Brennstoffe verbunden ist – und welche Länder oder Regionen in Zukunft profitieren könnten.
Denn der Rückgang bei den Öl- und Gasfeldern betrifft Europa sehr viel stärker als andere Weltregionen. Russland, Saudiarabien und andere grosse Produzenten im Nahen Osten dagegen haben hier gemäss den Daten bessere Aussichten.
Laut dem Bericht sinken die Fördermengen der riesigen Ölfelder im Nahen Osten um weniger als 2 Prozent pro Jahr. Kleinere Offshore-Felder in Europa verlieren dagegen durchschnittlich mehr als 15 Prozent pro Jahr.
Diese Entwicklung hängt auch vom Typ des Gases oder Erdöls ab. Bei Schiefergas ist der Rückgang zum Beispiel besonders drastisch: Ohne Investitionen sinkt die Fördermenge innerhalb eines Jahres um mehr als 35 Prozent und im Folgejahr um weitere 15 Prozent.
Das hat langfristige Folgen. Denn die Öl- und Gasversorgung hängt zunehmend von solchen unkonventionellen Öl- und Gasvorkommen ab. Noch stammen rund 70 Prozent der weltweiten Erdgasproduktion aus konventionellen Feldern, wo Gas mithilfe von Bohrlöchern aus der Erde gewonnen wird.
Aber fast der gesamte Rest der Produktion entfällt auf Schiefergas in den USA – also Gas, das aus Schiefergestein gewonnen wird. Diese Entwicklung hat die USA innerhalb von zwanzig Jahren auch zum weltgrössten Gasproduzenten gemacht.
Die USA als fossile Supermacht
Insgesamt wird die Öl- und Gasproduktion von einer kleinen Anzahl von riesigen Feldern dominiert, im Nahen Osten, in Eurasien und Nordamerika. Zusammen machten sie im vergangenen Jahr laut der IEA fast die Hälfte der weltweiten Öl- und Gasproduktion aus.
In dieser relativ kleinen Gruppe wetteifern die Länder miteinander um die globale Vormachtstellung. Nirgendwo sonst kann man das derzeit so gut beobachten wie in den USA. Denn Donald Trump hat sich zum Ziel gesetzt, die heimische Erdöl- und Gasbranche zu einem der zentralen Exportsektoren des Landes zu machen.
Schiefergas hat die USA als Gasproduzenten gross gemacht, es ist aber auch eine Schwachstelle gegenüber den anderen grossen Produzenten der Welt. Denn die Öl- und Gasproduktion in den USA geht laut der IEA schneller zurück als jene in Ländern im Nahen Osten und in Russland. Dort wird das meiste Öl auf konventionellen Riesenfeldern gefördert.
Ohne weitere Investitionen werde sich das weltweite Öl- und Gasangebot auf wenige Länder in diesen Regionen konzentrieren, mahnt die IEA. Diese Entwicklung hätte natürlich grosse Auswirkungen auf die Energiesicherheit Europas – und gibt sowohl Klimaaktivisten als auch Vertretern der fossilen Brennstoffe überzeugende Argumente in die Hand, für den Ausbau der Erneuerbaren oder weitere Investitionen in die heimische Gas- und Ölproduktion zu plädieren.
(K)eine Zukunft für die fossilen Brennstoffe
Die klimapolitische Forderung nach einem Aus für Investitionen in die fossilen Brennstoffe bringt europäische Politiker in eine Zwickmühle.
Langfristig soll die Energiewende der EU dazu verhelfen, im globalen Wettkampf um neue Märkte und grüne Technologien die Oberhand zu gewinnen. In der Zwischenzeit könnten die Länder im Nahen Osten oder Russland jedoch ihren Einfluss auf die weltweite Öl- und Gasversorgung ausweiten. Die Abhängigkeit von ihnen könnte zunehmen.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der IEA-Studie kommt vor diesem Hintergrund nicht überraschend. Die IEA wird seit Monaten von der Trump-Regierung unter Druck gesetzt. Amerikanische Politiker werfen der Agentur vor, jüngst Fragen zur Energiesicherheit und zur Rolle von fossilen Brennstoffen zugunsten der Energiewende und erneuerbarer Energien ausgeblendet zu haben.
Tatsächlich hat sich die IEA unter der Führung von Fatih Birol – einem ehemaligen Mitarbeiter des Erdölkartells Opec – verstärkt mit Themen der Energiewende und grünen Technologien beschäftigt. Dabei wird der Agentur jedoch auch regelmässig vorgeworfen, die Wachstumsraten für die Solarenergie lange unterschätzt zu haben.
Für Birol zeichnet sich derweil eine langfristige Entwicklung deutlich ab: Die Nachfrage nach Erdöl wird sinken. «Wir beobachten einen Rückgang des Ölverbrauchs», sagte er vergangene Woche an der Gastech-Konferenz in Mailand. Daran könnten auch Reden nichts ändern.
Der Grund dafür sei China, sagte Birol. Kein Land habe mehr Einfluss auf die Entwicklung der Erdölnachfrage als China. Und dort wachse derweil die Nachfrage nach Elektroautos, die Abhängigkeit von importiertem Erdöl sinke. Das steht in Kontrast zu den Prognosen aus den USA. Der amerikanische Innenminister Doug Burgum hatte kurz vor Birol die amerikanischen Energiepläne an der Gaskonferenz vorgestellt – inklusive goldener Zeiten für die Öl- und Gasbranche.