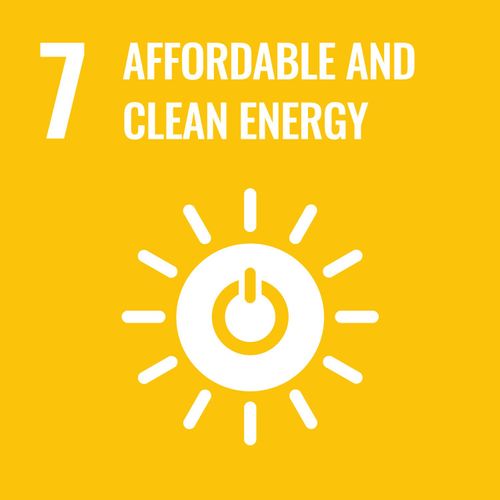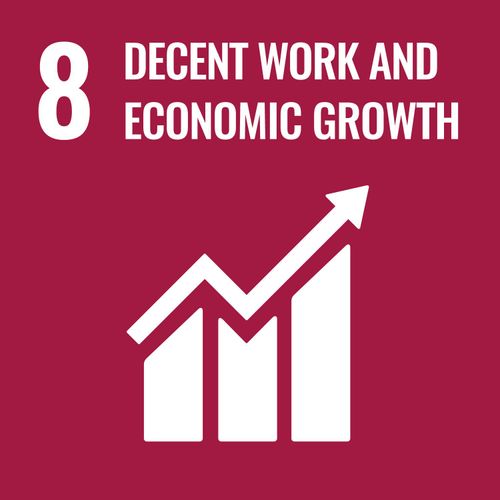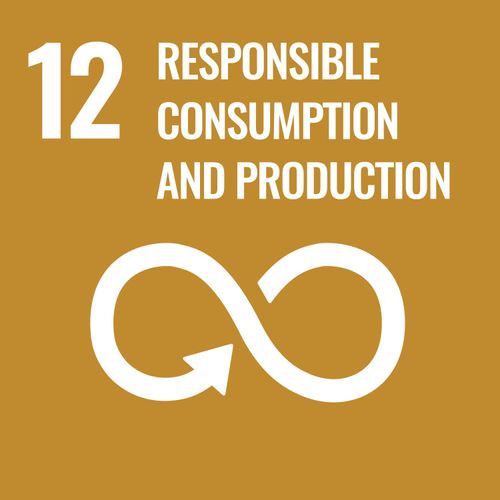«Klimapolitik braucht Realismus», hält die deutsche CDU in ihrem Wahlprogramm fest. «Das Ziel ist klar, der Weg ist pragmatisch und realistisch», sagt die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die geplanten Emissionsreduktionen der EU. In Grossbritannien machte die gegenwärtige Anführerin der konservativen Tories kurzen Prozess: «Netto null bis 2050 ist unmöglich», so Kemi Badenoch.
Badenochs Aussage schlug in der Klimablase wie eine Bombe ein. Aktivisten waren ausser sich. Denn die Konservativen hatten Grossbritannien 2019 als erstes Land der Welt verpflichtet, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren und den Rest mittels Wäldern oder Technologien wettzumachen. Die EU folgte im Jahr darauf. Treiber war die Erkenntnis, dass mithilfe der Klimaneutralität die Erderwärmung gebremst werden könne.
Doch die Skepsis gegenüber dem gängigen Netto-Null-Narrativ ist als Impuls wichtig. Anstatt uns weiter in ideologisch puristischen Debatten zu verlieren, sollten wir die Erreichbarkeit der Klimaziele kühl durchrechnen und Lösungsansätze pragmatisch abwägen. Das ist heute dringender denn je.
Denn die Klimapolitik ist vorerst gescheitert, Emissionen steigen weltweit weiter an. «Die Menschen wissen, dass die derzeitige Debatte über den Klimawandel von Irrationalität durchzogen ist», schrieb der ehemalige britische Premierminister Tony Blair neulich völlig zu Recht. Die meisten Menschen akzeptierten zwar, dass der Klimawandel menschengemacht sei, so Blair. Aber sie wendeten sich von der Politik ab, weil die vorgeschlagenen Lösungen nicht überzeugten.
Dieses Muster zeigt sich in ganz Europa – insbesondere dort, wo konservative Parteien jüngst die Wahlen gewonnen haben.
Zu lange haben sich Aktivisten, grün gesinnte Politiker und auch Forscher vor harten Auseinandersetzungen gedrückt. Die Energiewende wirft schwierige gesellschaftspolitische und soziale Fragen auf. Das grüne Bild glücklicher Bürger, die saubere Luft atmen, (Lasten-)Fahrrad fahren und autofreie Fussgängerzonen geniessen, ist ideologische Realitätsverweigerung.
Aufgrund der Energiewende werden Menschen ihre Stellen verlieren und Regionen ihre Industrien. Natürlich werden auch Jobs geschaffen, und Wirtschaftszweige werden wachsen. Aber das wird nicht immer dort geschehen, wo sie wegfallen. Zudem werden Milliardenbeträge in den Umbau der Netto-Null-Wirtschaft fliessen müssen, vor allem in Schwellenländern. Nicht jede grüne Investition wird sich für Unternehmen rechnen. Ins Flugzeug steigen, Auto fahren, Fleisch essen: All dies wird teurer werden, wenn die Kosten der fossilen Brennstoffe und der anfallenden Emissionen eingepreist werden.
Es war ein grosser Fehler, diese Realität auszublenden. Die Motivation dahinter mag nachvollziehbar sein. Viele Nichtregierungsorganisationen wollten keine Zweifel am grünen Kurs aufkommen lassen und die fragile Unterstützung für den Klimaschutz nicht gefährden.
Jetzt zahlt die Klimabewegung einen hohen Preis für ihre Haltung. Denn ihr Netto-Null-Purismus hat dazu geführt, dass Energietechnologien und Lösungsansätze ideologisch ausgebremst wurden. Weil sie dem aktivistischen Bild einer Welt, die allein durch erneuerbare Energien angetrieben wird, nicht entsprechen.
Dabei ist niemandem geholfen, wenn einzelne Länder eine perfekte Energiewende mit Wind- und Sonnenkraft schaffen und keiner folgt. Neben der Wind- und der Solarenergie müssen wir auch andere Technologien prüfen und zulassen, die Emissionen reduzieren. Und solche, die CO2 entfernen können. Auch wenn wir sie nicht mögen. Jetzt gilt es, uns auf die zunehmenden Risiken des Klimawandels einzustellen und vorzubereiten.
Mehr Mut zum Streit
Dabei sollten gerade die Befürworter der Netto-Null-Ziele eine ehrliche Debatte über die Kosten und Nutzen der Klimaneutralität, über die CO2-Bepreisung und über das Portfolio grüner Energietechnologien unterstützen. Schliesslich haben sie überzeugende Argumente in der Hand.
Denn der Klimawandel findet statt. Die Temperaturen steigen und beeinträchtigen unsere Gesundheit, fordern Menschenleben und senken die Arbeitsproduktivität. Dagegen müssen wir uns wappnen.
Die Schäden des Klimawandels übersteigen die Kosten der Energiewende. Offizielle Studien belegen das. Eine Analyse der britischen Finanzaufsicht zeigt: Steigt die Temperatur um drei Grad, schrumpft die britische Wirtschaftsleistung deutlich stärker als bisher angenommen. Umgekehrt: Die Energiewende kostet weniger als erwartet.
Darüber hinaus kann die Energiewende auch die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken – falls die EU ihre Chance nutzt. Dass in Europa nun der Widerstand gegenüber grünen Auflagen wächst, statt zu schwinden, hat jedoch einen weiteren Grund.
Die Energiewende wurde von vielen Aktivisten dafür genutzt, linke Überzeugungen «durch die Hintertür einzuschmuggeln». Das reichte vom Bemühen, das Paradigma ewigen Wachstums umzuwerfen, bis dahin, das Fahrverhalten von Menschen, ihre Essensvorlieben oder ihre Feriengestaltung zu bestimmen. Heute stösst die grüne Doktrin zunehmend auf harten Widerstand. Und das zu Recht.
Absolute Wahrheiten in der Klimapolitik
Ein Beispiel sind die Debatten über die teuren Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) wie auch über die Atomkraft. Beide müssen gemäss Klimamodellen eine Rolle spielen. Das heisst weder, dass sie die einzigen Heilsbringer sind, noch, dass sie keine Risiken bergen. Aber sie sind Teil des klimapolitischen Werkzeugkastens.
Noch halten sich die fossilen Brennstoffe hartnäckig im Energiesystem. Erdöl, Gas und Kohle sind billig, und die Nachfrage nach ihnen wächst – auch wenn ihr Energieanteil dank dem Ausbau der erneuerbaren Energien sinkt.
Am Energiemix ändern die Rufe nach dem sofortigen Ausstieg vorerst nichts. Aber die Kampagnen verbrauchen sehr viel politisches Kapital. Stattdessen sollten der zunehmend begrenzte politische Wille und knappe Budgets darin investiert werden, Voraussetzungen für einen Markt für grüne Technologien zu schaffen.
Dazu gehören grüner Stahl und grüner Zement, aber auch nachhaltige Kraftstoffe für Flugzeuge und Schiffe. Die Technologien dafür gibt es. Deren Durchsetzung scheitert heute an ihrer Wirtschaftlichkeit und der gesellschaftspolitischen Machbarkeit. Dafür ist es auch notwendig, den Emissionshandel zu stärken und auszuweiten, um CO2 einen Preis zu geben.
Die fossilen Brennstoffe werden noch Jahrzehnte zum Energiemix gehören. Darum braucht es Marktbedingungen und Regeln auch für diejenigen Technologien, die Kohlendioxid direkt bei der Entstehung abscheiden, aus der Atmosphäre entfernen und permanent speichern können. Die Erdöl-, Gas- und Kohleindustrie muss entsprechend zur Verantwortung gezogen werden.
Gleichzeitig dürfen Technologien zur CO2-Abscheidung nicht dafür genutzt werden, die Verwendung fossiler Brennstoffe weiter auszubauen. Die Technologien bringen Risiken mit sich. Das bedeutet nicht, sie nicht zu nutzen. In Europa kommt die Debatte dazu und zur Atomkraft in Fahrt.
In Deutschland werden Gegner und Befürworter der Atomkraft jedoch hysterisch, sobald es darum geht, diese Energieform zu verdammen oder zu verteidigen. Etwas mehr Gelassenheit wäre förderlich, um kühl abzuwägen, ob sich Kosten und Risiken angesichts der Klimarisiken und der Anforderungen des zukünftigen Energiesystems lohnen.
Sind Kosten und Risiken vertretbar, sollte die Atomkraft genutzt werden. In vielen europäischen Ländern dreht die Haltung. Neue Meiler gehen ans Netz. Die Laufzeit bestehender Kraftwerke wird verlängert. Letzteres unterstützen auch grüne Parteien – etwa in Belgien.
Die aufkommende Skepsis gegenüber den Klimazielen rüttelt an ideologischen Grundpfeilern und den vermeintlich absoluten Wahrheiten der Klimapolitik. Die Wahl Donald Trumps, der zurzeit den klimapolitischen Apparat in den USA zerlegt, beschleunigt diese Dynamik. Aber eine Realität ändert sie nicht: Der Klimawandel schreitet voran, und die Emissionen steigen weiter.
Nur weil wir diese Realität akzeptieren, werfen wir die Klimaziele des Pariser Abkommens nicht über Bord. Schon jetzt nutzen Verteidiger der fossilen Industrie die wachsende Skepsis, um die Klimapolitik grundsätzlich zu hinterfragen. Ihnen kommt die Debatte nur allzu gelegen, um auf dem Status quo zu beharren, ohne sich als Klimaschutz-Bremser zu offenbaren.
Die Klimaziele aufzugeben, wäre jedoch nur eine andere Form der Realitätsverweigerung. Fossile Brennstoffe müssen aus dem Energiesystem verdrängt werden. Netto null Emissionen sind notwendig, um den CO2-Anstieg in der Atmosphäre zu bremsen. Sonst heizt sie sich weiter auf.
Die Zeit für klimapolitischen Purismus ist abgelaufen. Klimaziele sollten wir uns dennoch setzen: Ohne sie riskieren wir grosse Schäden und hohe Kosten für alle in einer brennend heissen Welt.