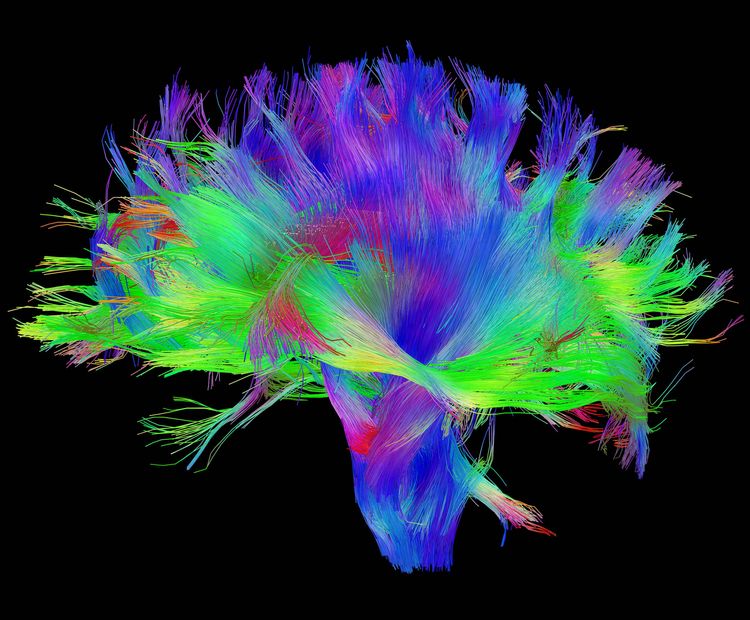Der Klimawandel macht sich in der Schweiz besonders deutlich bemerkbar. Schneller als in den meisten Staaten der Erde steigen hierzulande die Temperaturen – und Experten rechnen für die nächsten Jahre mit neuen Rekordwerten. Die Alpengletscher verlieren sichtbar an Masse, Hitzewellen und Trockenperioden häufen sich, ebenso Extremereignisse wie Überschwemmungen, Bergrutsche oder Murgänge. Die Folgen sind in jedem Fall erheblich: Sie reichen von massiven Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft bis hin zu weiter steigenden Kosten für Schutz- und Anpassungsmassnahmen. Vor diesem Hintergrund stimmt die Schweizer Bevölkerung am 8. März über die Einführung eines nationalen Klimafonds ab.
Die von SP und Grünen lancierte Volksinitiative mit dem offiziellen Titel «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» sieht vor, dass zusätzliche finanzielle Mittel für Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität bereitgestellt werden. Die konkrete Ausgestaltung ist politisch umstritten. Befürworter sehen in dem neu zu schaffenden Fonds ein zentrales Instrument, um die Klimaziele der Schweiz zu erreichen – im Kern geht es um Netto-Null-Emissionen bis 2050. Ausserdem soll die Energieversorgung des Landes nachhaltig gesichert werden. Die Gegner wiederum warnen vor allem vor hohen Kosten, neuen Abgaben und einer Schwächung der Schuldenbremse. Sie verweisen auf die bereits ergriffenen Massnahmen und sind der Ansicht, dass das Land bereits genug für den Schutz des Klimas tue.
Milliarden Franken pro Jahr
Die Einrichtung eines nationalen Klimafonds soll nach den Vorstellungen der Initianten jährlich mit 0,5 bis 1 Prozent der Wirtschaftsleistung alimentiert werden – das entspräche aktuell 3,9 bis 7,7 Milliarden Franken pro Jahr. Mit dem Geld sollen gezielt Projekte gefördert werden, die zur Verringerung der umweltschädlichen Treibhausgase beitragen oder eine Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Dazu zählen etwa energetische Gebäudesanierungen, der Ausbau erneuerbarer Energien, klimafreundliche Mobilität, technologische Innovationen in Industrie und Landwirtschaft sowie Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität.
Die Initianten argumentieren, dass der Schutz von Klima und Natur nicht allein auf die individuelle Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger verlagert werden könne. Es seien «massive öffentliche Investitionen nötig, um erneuerbare Energien zu fördern und in der Schweiz so viel nachhaltige Energie wie möglich zu produzieren», heisst es in der Darstellung der Initiative.
Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt, ist für eine Annahme die doppelte Mehrheit von Volk und Kantonen erforderlich. Über die konkrete Ausgestaltung des Fonds müsste später das Parlament entscheiden.
Wirtschaftliche Chancen
Für die Befürworter ist der Klimafonds eine notwendige Antwort auf die Dringlichkeit der Klimakrise. Sie kritisieren, dass bisherige Instrumente zu fragmentiert seien und nicht ausreichten, um die Emissionsziele rechtzeitig zu erreichen. Ein Fonds ermögliche «planbare Investitionen über mehrere Jahre» und schaffe Planungssicherheit für Kantone, Gemeinden und Unternehmen.
Zudem verweisen sie auf wirtschaftliche Chancen. Investitionen in die Energiewende könnten neue Arbeitsplätze schaffen und den Innovationsstandort Schweiz stärken. Laut Initiativkomitee kommt Nichthandeln teurer: «Für jeden Franken, der heute in Klimaschutzmassnahmen investiert wird, würden in Zukunft vier oder fünf Franken eingespart.» Als Belege nennen die Befürworter die hohen Kosten, die bei zurückliegenden Naturkatastrophen entstanden seien.
Ein weiteres zentrales Argument betrifft die Energieversorgung. Rund 70 Prozent der in der Schweiz verbrauchten Energie stammen aus importierten fossilen Energieträgern. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, wie verletzlich dieses System sei und wie wichtig eine stärkere inländische Produktion erneuerbarer Energie werde.
Unterstützung erhält die Initiative auch von Umweltorganisationen. Der WWF zum Beispiel warnt vor weiteren Investitionen in fossile Infrastrukturen. «Um ein lebenswertes Klima zu erhalten, dürfen wir nicht mehr in Kraftwerke, Fahrzeuge und Heizungen mit fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle investieren», so Patrick Hofstetter, Klima- und Energieexperte des WWF Schweiz.
Risiko zusätzlicher Schulden
Bundesrat und Parlament empfehlen hingegen die Initiative zur Ablehnung. Sie anerkennen den Handlungsbedarf beim Klimaschutz, halten einen neuen Fonds jedoch für nicht nötig. In der Botschaft des UVEK heisst es, Bund, Kantone und Gemeinden täten «bereits viel, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen». Allein dem Bund stünden jährlich rund zwei Milliarden Franken für Klima- und Energiemassnahmen zur Verfügung. Weitere 600 Millionen Franken würden für die Biodiversität eingesetzt.
Tatsächlich enthalten das Klima- und Innovationsgesetz, das revidierte CO2-Gesetz sowie das revidierte Energiegesetz eine ganze Pallette von Fördermassnahmen und Anreizen. Für den Bundesrat ist dabei unbestritten, dass für das Netto-Null-Ziel und den Ausbau der heimischen erneuerbaren Energien weitere Investitionen nötig sind. Er ist jedoch der Ansicht, dass der heute eingeschlagene Weg mit dem Mix aus gezielten Fördermassnahmen, Vorschriften und marktwirtschaftlichen Instrumenten genug wirksame Anreize zur Reduktion der Treibhausgasemissionen setzt.
Besonders kritisch werden von den Gegnern die finanziellen Auswirkungen gesehen, die eine Annahme der Volksinitiative hätte. Die Initiatoren machten keine konkreten Angaben zur Finanzierung des Klimafonds, heisst es, während die Ausgaben «zumindest vorübergehend nicht der Schuldenbremse unterstellt wären». Befürchtet wird eine Schwächung der Schweizer Finanzpolitik. Der Bund müsste nach Mitteilung des UVEK jährlich zwei- bis viermal mehr Geld als heute für die Klima- und Energiepolitik bereitstellen.
Zudem warnt der Bundesrat vor einem ineffizienten Einsatz der Mittel. Es bestehe das Risiko von Mitnahmeeffekten: Mit dem Fonds würden unter Umständen «Projekte mitfinanziert, die Private ohnehin umgesetzt hätten». Aus ordnungspolitischer Sicht wird kritisiert, die Initiative setze «einseitig auf Bundessubventionen» und schwäche damit die Eigenverantwortung und das in der Verfassung verankerte Verursacherprinzip. «Das ist der falsche Weg», so das UVEK. «Die Kosten für Umweltschäden haben primär die Verursacher und nicht die Allgemeinheit zu tragen.» Statt über staatliche Subventionen soll Klimaschutz über Anreize, Lenkungsabgaben und klare Vorgaben erfolgen, betonen die Gegner der Initiative.
Prioritäten verschoben
Beim Urnengang über den Klimafonds steht damit mehr zur Abstimmung als eine finanzpolitische Detailfrage. Berührt sind grundlegende Fragen zur Rolle des Staates, zur Finanzierung des ökologischen Umbaus und zur Verantwortung von Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Ja könnte neue Handlungsspielräume eröffnen, ist aber mit Risiken verbunden, ein Nein würde den bisherigen Kurs bestätigen.
Und wozu neigen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mehrere Wochen vor der Abstimmung? Laut einer ersten, von der SRG in Auftrag gegebenen Umfrage vom Januar dieses Jahres lehnen 60 Prozent der Befragten die Volksinitiative ab. Nur 35 Prozent äusserten sich zustimmend. Das ist bisher nur eine Momentaufnahme. Das Umfrageergebnis lässt aber erkennen, dass die Vorlage «überraschend kritisch beurteilt» werde, so Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern in einer Medienmitteilung. Der Krieg in Europa, ein brüchiges transatlantisches Verhältnis, eine Welt in Schieflage – all das habe zu einer Prioritätenverschiebung geführt. «Der Fokus auf die Bundesfinanzen und die Sicherheit führen dazu, dass die Klimadiskussion abgewürgt wird», so Golders Einschätzung.
Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung wird die Herausforderung bestehen bleiben, Klimaschutz, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Stabilität miteinander in Einklang zu bringen. Die Entscheidung an der Urne wird diese Fragen nicht abschliessend beantworten – sie dürfte aber den klimapolitischen Kurs der Schweiz für die kommenden Jahre prägen.