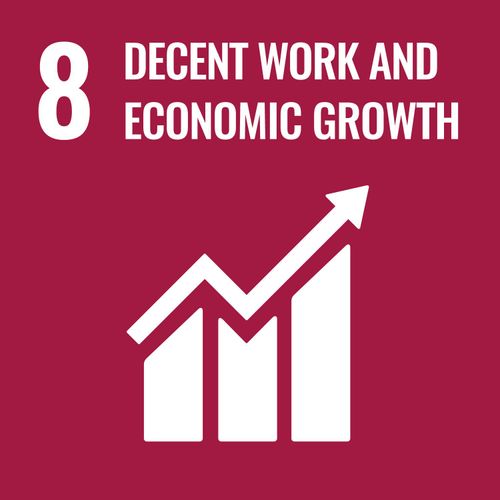Christoph Mäder, was verstehen sie unter sozialer Nachhaltigkeit?
Christop Mäder: «Genau wie bei der ökologischen und der ökonomischen Nachhaltigkeit geht es darum, dass wir die langfristigen Auswirkungen berücksichtigen, wenn wir in der Gegenwart Entscheidungen fällen. Unser heutiges Tun darf den Wohlstand künftiger Generationen nicht schmälern. So sind wir beispielsweise gefordert, unsere Sozialwerke nachhaltig und finanziell solide auszugestalten, damit auch jene, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, auf eine gesicherte Altersvorsorge zählen können.»
Wie sozial nachhaltig ist die Schweiz heute aufgestellt?
«In vielen Bereichen, etwa bei der Einkommensverteilung und -mobilität oder der sozialen Absicherung stehen wir vergleichsweise sehr gut da. Mit dem demografischen Wandel stehen wir jedoch vor einer grossen, noch weitgehend ungelösten Herausforderung. Die damit einhergehenden Probleme werden nun immer stärker sichtbar.»
Woran machen sie das fest?
«Der Arbeitskräftemangel in der Schweiz ist bereits heute eklatant. Viele Unternehmen quer durch alle Branchen bekunden grosse Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Und die weiteren Aussichten sind düster: Der Anstieg der Erwerbsbevölkerung durch die Babyboomer hatte in den letzten Jahrzehnten positive Impulse auf die Gesamtwirtschaft. Das kippt jetzt ins Gegenteil. So zahlreich, wie die Babyboomer einst in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, so zahlreich treten sie nun auch wieder aus. Und weil die Geburtenrate seit Längerem tief ist, rücken Jahrgänge nach, die diesen Wegfall an Arbeitskräften niemals kompensieren können.»
Das klingt paradox: Die Bevölkerungszahl der Schweiz erreicht bald 9 Millionen, aber wir haben trotzdem zu wenig Leute?
«Ja, denn für unseren Wohlstand und die Finanzierung der Altersvorsorge sind die Erwerbstätigen relevant, und deren Zahl nimmt seit dem Jahr 2020 ab, sofern wir das nicht über die Zuwanderung kompensieren. 2029 wird die Zahl der Personen, die ins Pensionsalter kommen, jene der nachrückenden Jungen um über 30'000 Menschen übertreffen. Bis 2040 sind es kumuliert rund 430'000. Diese Hochrechnung gibt aber noch keine Auskunft darüber, wie viele Personen tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden. Die Grösse der Lücke wird zusätzlich beeinflusst durch die Wirtschaftsentwicklung. Ebenso spielt eine Rolle, wie viele Personen im erwerbsfähigen Alter tatsächlich arbeiten. Und schliesslich wird entscheidend sein, ob wir auch künftig attraktiv sind für Zuwanderer.»
Zuwanderung ist ein hoch umstrittenes Thema. Erst kürzlich wurde wieder eine neue Initiative lanciert, um sie zu bremsen.
«Ohne Zuwanderung werden wir das Demografie-Problem nicht lösen können. Es ist nicht möglich, unsere hohe Wertschöpfung allein mit inländischer Arbeitskraft zu erzielen. Die Unternehmen sind auf den Zuzug von qualifizierten Ausländerinnen und Ausländern angewiesen. Vor allem die Personenfreizügigkeit mit den EU/EFTA-Staaten sollten wir unbedingt beibehalten. Vier von fünf Personen, die auf diesem Weg in die Schweiz kommen, sind erwerbstätig. Ihre Erwerbsquote liegt sogar leicht höher als jene der Einheimischen.»