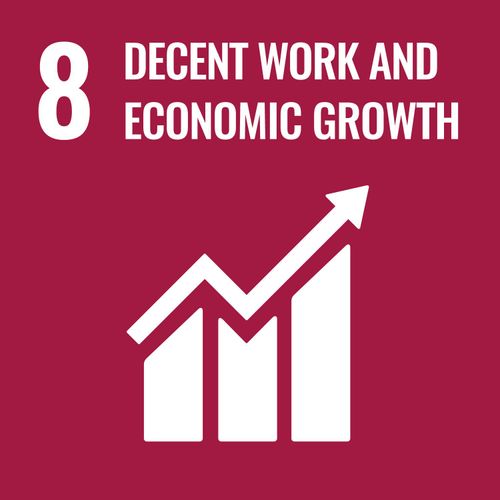Unter ihren Studentinnen, so erzählt Rost, sei das Egg-Freezing, das Einfrieren der Eier, ein grosses Thema. Mit der biologischen Uhr im Nacken versucht man, sich mehr Zeit zu organisieren. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Sowohl die gewollte wie auch die ungewollte Kinderlosigkeit habe zugenommen, so die Soziologieprofessorin. Rost, die selbst mit 37 Jahren einen Sohn bekommen hat und in einer Patchworkfamilie lebt, empfiehlt, die Kinder früher zu bekommen.
Der ideale Zeitpunkt sei während des Studiums oder der Ausbildung, argumentiert sie. Wer sich beim nächtlichen Clubbing etwas einschränke, habe in dieser Lebensphase viel Zeit und Energie. Wenn dann im Alter von 30 Jahren die Zeit komme, in der die Karriere richtig aufgebaut werden müsse, seien die Kinder schon nicht mehr ganz klein.
Die Fehler der eigenen Mütter vermeiden
Hinter der Kinderlosigkeit beziehungsweise dem Wunsch, nur ein Kind zu haben, steckt aber oft auch ein bewusster Entscheid. «Kinder sind eine wahnsinnige Verpflichtung.» Die Vorstellung von einem erfüllten Leben, einer Karriere, von Unabhängigkeit könne dadurch infrage gestellt werden. Soziologen sprechen von «Optionsverengungen»: Der Entscheid für etwas schliesst anderes aus. Heute fragen sich viele, warum sie einen Weg wählen sollten, der ihr bisher gutes Leben gefährdet.
Eine grosse Rolle beim Geburtenrückgang spielt auch die bessere Ausbildung der Frauen. Gerade hochqualifizierte Frauen haben häufiger keine oder weniger Kinder, wie es im deutschen Demografieportal heisst. Früher war der Karriereverzicht für viele Frauen eine normative Vorgabe. Heute wird genauer abgewogen, ob sich die Einschränkungen, die Kinder und Familie mit sich bringen, tatsächlich lohnen beziehungsweise wie sich das Glück steigern lässt.
Kinder: vom ökonomischen Wert zur Belastung
Geprägt wird diese Überlegung auch von einer veränderten wirtschaftlichen Logik. Bis etwa zum Zweiten Weltkrieg «lohnte» es sich, Kinder zu haben. Ihnen oblag es, ihre Eltern im Alter zu versorgen. Mit dem Ausbau des Sozialstaates wurde diese Pflicht zunehmend obsolet. «Damit wurden Kinder von einem ökonomischen Wert zu einer ökonomischen Belastung», stellt Rost fest.
Die Professorin ist allerdings weit davon entfernt, die Sicht auf Kinder auf die Belastungen zu verengen. Als Soziologin sagt sie: «Kinder haben nicht nur einen psychologischen und sozialen Wert, sondern auch einen transzendentalen Wert.» Als Mutter sagt sie: «Für mich ist es das Beste in meinem Leben.» Mit Kindern erfahren viele einen tieferen Sinn. Ihr persönlich habe das Elternsein in Lebenskrisen einen Halt gegeben, den sie sonst bei weitem nicht gehabt hätte.
Er kümmert sich um den Rasenmäher, sie um das Kind
Gesellschaftlich beobachtet die Soziologin einige Trends dennoch kritisch. Dazu zählt sie eine Retraditionalisierung durch die Familie. Sobald Kinder da sind, verstärken sich bei vielen Paaren traditionelle Rollenmuster. Er kümmert sich um den Rasenmäher, sie um das Kind. Wenn nicht beide die gleichen Erwartungen hätten, könnten so leicht Konflikte entstehen. Junge Frauen, die das erahnen, setzen sich dem in einer Welt voller Wahlmöglichkeiten womöglich nicht unnötig aus.
Gerade weil die Familiengründung heute ihren verbindlichen Normcharakter verloren hat, sind die Glückserwartungen an sie gestiegen. «Die Romantisierung der Familie hat zugenommen», sagt Rost. Man wünsche und erwarte, dass alles harmonisch verlaufe. Familie und Arbeit, so der Anspruch, müssen gut miteinander vereinbar sein.
Abschreckend wirkt dabei, dass die jungen Erwachsenen in ihrem Umfeld wahrnehmen, wie aus dem Ideal der beabsichtigten Work-Life-Balance in der Realität oft eine harte Doppelbelastung wird. Sie sehen die Konflikte bis hin zu Trennungen und zweifeln, dass sich tatsächlich alles idealtypisch verbinden lässt. «Es wird als zu viel erlebt», sagt Rost.
DDR: Neid auf die Hausfrauen
Die Soziologin macht in diesem Zusammenhang auf häufig nicht hinterfragte Wertehaltungen aufmerksam. Frauen, die nicht erwerbstätig sind, gelten heute als rückständig. Rost, die in Ostdeutschland aufwuchs, hat dazu ein ambivalentes Verhältnis. «In der DDR mussten alle voll arbeiten.» Wegen der Auswanderung in den Westen habe es zu wenig Arbeitskräfte gegeben.
Auf Frauen konnte deshalb nicht verzichtet werden. «Wir in der DDR blickten mit Neid und Unverständnis auf das Modell der Hausfrau.» Der heutige Fokus auf Frauenkarrieren komme ihr manchmal vor wie eine DDR 2.0, witzelt Rost. Er entspringe, so meint sie, eben nicht nur einer feministischen Agenda, sondern sei auch dem Druck aus der Wirtschaft geschuldet, den Fachkräftemangel abzufedern.
Aus der Alterspyramide wird ein Pilz
Was passiert, wenn sich der Trend zur Individualisierung fortsetzt, die Geburtenrate weiter sinkt und die Zahl der Kinder in Zukunft noch mehr abnimmt? Grundsätzlich, so könnte man argumentieren, ist eine kleinere Bevölkerung kein Problem, ökologisch sogar ein Vorteil. Für Rost ist das dennoch keine schöne Vorstellung. Sie denkt dabei an Japan, wo in Altersheimen immer mehr Pflegeroboter eingesetzt werden.
Aus sozialer Perspektive sei es gut, wenn eine Gesellschaft ausgeglichen sei und die Alterspyramide nicht zu einem Pilz werde. «Das verringert das Konfliktpotenzial zwischen den Generationen.» Rost argumentiert zudem, dass Wirtschaft, Wohlfahrt und Sozialstaat auf Nachwuchs ausgelegt seien. Gleichzeitig konzediert sie aber auch, dass das Generationenmodell des Sozialstaates mit der Umverteilung von Jung zu Alt kein gutes Argument sei, um nach einer Stabilisierung der Geburtenrate zu rufen. Niemand will Kinder bekommen, nur damit diese dereinst die Altersvorsorge retten.
Kreative Lösungen
Was würde es brauchen, damit die Menschen wieder mehr Kinder möchten – oder mindestens nicht noch weniger? Unterstützungsmassnahmen wie Krippensubventionen hätten einen Effekt, sagt Rost. Sie nehmen wirtschaftlichen Druck von den Familien. Dennoch sollten sie nicht überschätzt werden. Die Diskussion um die Kinder werde oft ökonomisch geführt, der Kinderwunsch sei aber nicht ökonomisch motiviert.
Entscheidend sei, so Rost, das Gesamtpaket. «Hier müssen wir kreativ überlegen.» Einen Ansatzpunkt sieht die Soziologin in einem positiveren Bild von der Familie. Es sollte in Gesellschaften für junge Personen wieder vermehrt als attraktiv, wünschenswert und nicht einengend wahrgenommen werden. Es helfe nicht, wenn Karrierefrauen heroisiert oder verteufelt würden, Hausfrauen als nicht zeitgemäss dargestellt würden oder Hausmänner als woke Nichtsnutze abgetan würden. Gefragt sind attraktive, nicht wertvorbeladene Modelle. Zum Beispiel die coolen, jungen Nicht-Helikopter-Eltern, welche sich in Ausbildung befinden und sich auf selbständige Berufswege vorbereiten.