Hilfe, Sackgasse? Nein – auch im KI-Zeitalter kann man vieles studieren. Berufslehren gehen sowieso
Künstliche Intelligenz schürt die Angst vor überflüssigen Berufen und falschen Karrierewegen. Vieles davon ist Panikmache.
1
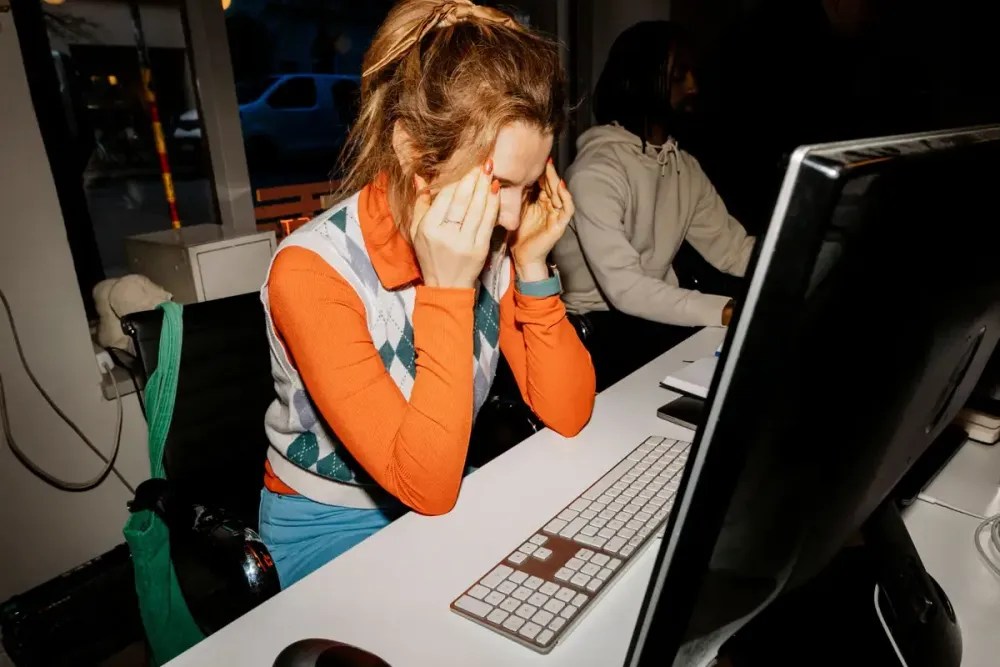
Maskot / Getty
Künstliche Intelligenz schürt die Angst vor überflüssigen Berufen und falschen Karrierewegen. Vieles davon ist Panikmache.
1
6 Min. • • Christin Severin, «Neue Zürcher Zeitung»
Künstliche Intelligenz (KI) ist so gut, dass den Arbeitnehmern angst und bange werden kann. Was unterscheidet mich eigentlich noch von ihr? Und welche Fähigkeiten kann sie auch in fünf oder zehn Jahren nicht ersetzen? Schulabgänger, ob sie nun studieren oder eine Berufslehre wählen, kommen an dieser Frage nicht vorbei. Wer die ganze Karriere vor sich hat, will die Weichen richtig stellen und nicht in einer Sackgasse landen.
Doch von diesen scheint es viele zu geben. Informatik? O nein, heisst es, KI kann coden, Programmierer braucht es bald nicht mehr. Jura? KI analysiert Gesetze in kürzester Zeit. Eine kaufmännische Ausbildung? Quasi tot, Routinearbeiten haben keine Zukunft.
«Die Behauptung, KI führe zu Massenarbeitslosigkeit, macht mich fassungslos», sagt die Digitalexpertin und Hochschuldozentin Sarah Genner. «Medien verbreiten solche Schreckensszenarien zwar gerne, aber es gibt keine Evidenz dafür.»
Die Tätigkeit ändert, die Arbeit bleibt
Und tatsächlich: Was aus der Ferne bedrohlich wirkt, verliert bei näherer Betrachtung den Schrecken. Schauen wir genauer hin, in diesem Fall zum Treuhänder, in Deutschland: Steuerberater. Ein typischer Bürojob, Jahresrechnung, Steuern, jedes Jahr wieder. Diese Spezies gilt gemeinhin als besonders gefährdet.
«Früher bekamst du als Treuhänder Belege und musstest sie abtippen», sagt Dominique Rey, Co-Founder und ehemaliger CEO von Numarics, einem Schweizer Fintech, das 2024 an die Bank Radicant verkauft wurde.
Die Arbeit sei für den Auftraggeber ein notwendiges Übel gewesen, sagt Rey. «Durch die Automatisierung hat sich das fundamental geändert.» Die Finanzdaten würden dank KI stärker als Planungsinstrument genutzt. So könne der Treuhänder beispielsweise frühzeitig warnen, wenn der Kunde in eine Überschuldung abzurutschen droht.
Vielen galt der Treuhänder als ein langweiliger Buchhalter. «Mit KI wird man zum Sparringpartner des Finanzchefs.» Rey sieht aber auch Grenzen. Die KI sei immer nur so gut wie die Person, die sie bediene. Wer sich im Fachgebiet gut auskenne, könne Skaleneffekte erreichen. Ohne eigene Expertise aber übersehe man Fehler und relevante Fakten.
Rey ist davon überzeugt, dass Treuhänder durch KI nicht überflüssig werden. «Wer bereit ist, sich auf die beratende Rolle zu fokussieren, bleibt relevant.» So wie beim Treuhänder ist es in sehr vielen Berufen. Die Aufgaben ändern sich, doch die Arbeit bleibt. Oft wird sie dabei spannender: weniger monotone Datenerfassung, mehr Interpretation und Dialog.
Die neuste Technologie gibt es in der Lehre «on the job»
Um die Berufsbildung habe sie überhaupt keine Angst, sagt Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich. Berufslehren werden nur angeboten, wenn die Firmen davon ausgehen, die Leute nachher zu beschäftigen. Wird ein Beruf wichtiger, gibt es mehr Lehrstellen und umgekehrt. Das System ist selbstregulierend. Die kaufmännische Lehre ist in der Schweiz immer noch die klare Nummer eins. Die Firmen investieren in den Nachwuchs. Lehren für Orgelbauer sind seltener. Doch die wenigen Fachleute sind weltweit gefragt.
In der Schweiz könne man eigentlich jede Lehre machen, sagt Renold. In Deutschland sei die Ausrichtung des dualen Bildungssystems nicht ganz so stark auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet, doch das Grundprinzip ist ähnlich. In den Firmen wird der Umgang mit der neusten Technologie «on the job» vermittelt. «Das macht die Berufsbildung in Bezug auf Wandel sehr resilient», so die Digitalexpertin Genner.
Mehr Stolpersteine im Studium
Doch was ist mit dem Studium? Junge Informatiker klagen, wie schwierig es für sie geworden sei, einen Job zu finden. Dabei galt ein Hochschulabschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten Mint-Fächern, bislang als Garantie für beruflichen Erfolg.
Doch auch hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. «In der Informatik geht es darum, dem Computer zu sagen, was er machen soll», sagt Nico Contatese, Informatik-Student an der ETH Zürich. Er lerne im Studium, wie man digitale Probleme effizient löse und wie Algorithmen funktionierten.
«Es gibt keinen Studiengang, von dem ich partout abraten würde.»
«Die Firmen setzen KI für immer weitere Bereiche ein. Darum werden sie auch in Zukunft Menschen brauchen, um neue Anwendungen zu bauen.» Er höre es auch von seinem Vater, der ebenfalls an der ETH Informatik studierte. Zwar seien nicht mehr alle damaligen Inhalten relevant. «Doch im Studium eignet man sich ein breites Wissen für immer neue Aufgaben an.»
«Low fire, low hire» trifft die Jungen
Dass junge Informatiker derzeit Mühe haben, im Beruf Fuss zu fassen, hat denn womöglich weniger mit KI zu tun als mit der Konjunktur. Der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell spricht von einer Kultur des «Low fire, low hire». Firmen führen zwar keine Massenentlassungen durch, aber sie stellen auch nicht ein.
In den USA ist das eine Spätfolge der Corona-Pandemie. Viele Firmen hatten damals ihr Personal schnell gefeuert. Als die Konjunktur anzog, fanden sie keine neuen Leute. Diesen Fehler wollen die Unternehmen trotz Handelskrieg und wirtschaftlicher Unsicherheit nicht wiederholen. Erfahrenen Berufsleuten kommt das zugute, Berufsanfänger haben das Nachsehen. Hochschulabsolventen empfinden den Umschwung umso schmerzlicher, als sie vor zwei Jahren noch stark umworben wurden.
Hinzu kommt: Wegen der Automatisierung von Routineaufgaben werden tatsächlich weniger klassische Einsteigerpositionen ausgeschrieben. Das bedeutet zwar grundsätzlich, dass Anfänger früher anspruchsvollere Aufgaben übernehmen können. Der Haken ist allerdings, dass viele Arbeitgeber zögern, diesen jungen Leuten ohne Berufserfahrung zu vertrauen.
Sofern Hochschulabsolventen keine Lehre oder Praktika gemacht haben, fehlt ihnen praktische Erfahrung: wie man mit Vorgesetzten umgeht, mit Kunden, die Druck machen, oder Kollegen aus anderen Altersgruppen. Solche Fähigkeiten werden aber immer wichtiger. «Viele Unternehmen wollen kein Risiko eingehen», erklärt Professorin Renold die Zurückhaltung vieler Arbeitgeber.
Lehrer, Ärzte, Juristen und andere Akademiker werden auch im KI-Zeitalter gefragt bleiben. Ein Chatbot, der zwanzig Primarschülern Rechtschreibung beibringt? Eine KI, die den verunfallten Patienten erst beruhigt, dann untersucht und operiert? Schwer vorstellbar.
Grundsätzlich haben es auch im KI-Zeitalter Studierende von Fächern leichter, die nah am Arbeitsmarkt sind. Den grössten Erfolg werden Mint-Absolventen haben, die KI-Technologien verstehen und strategisch anwenden können, prognostiziert die Zeitarbeitsfirma Randstad.
Nun heisst zwar das neue Mantra, dass sich der Mensch von der Maschine vor allem durch Kreativität, Empathie und kritisches Denken unterscheide. Daraus sollte man aber nicht unbedingt ableiten, dass ein Kunststudium der goldene Weg ist oder künftig vor allem kritisch denkende Philosophen gebraucht würden.
Sicher ist, wer Unsicherheit kann
Bisher stehen zwar auch klassische Geisteswissenschafter in der Schweiz selten auf der Strasse. Das liegt nach Ansicht von der Digitalexpertin Genner aber auch daran, dass nur etwa 20 Prozent eines Jahrgangs direkt nach dem Gymnasium ein Studium beginnen. Würde man die Gymnasialquote wie in anderen Ländern deutlich erhöhen, stiege damit sehr wahrscheinlich auch die Jugendarbeitslosenquote.
Vor diesem Hintergrund sagt Sarah Genner deshalb auch übers Studium: «Es gibt keinen Studiengang, von dem ich partout abraten würde.» Aufpassen sollte man aber, dass man ein Studium oder eine Lehre nicht nur wählt, weil sie auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist. Am Ende muss der Beruf auch zu den eigenen Interessen und der Persönlichkeit passen.
Das Wichtigste jedoch ist die Erkenntnis, dass die Menschen nicht gut darin sind, die Zukunft vorherzusehen. Wir wissen nicht, wo Neues, Unbekanntes und Innovatives entsteht. Keine 20-Jährige wird deshalb ihre Karriere heute gradlinig bis zur Rente durchplanen können. Das Leben kommt mit Sicherheit dazwischen. Wer damit umgehen kann, hat gute Karten.
Christin Severin, «Neue Zürcher Zeitung» (26.10.2025)
Hier publiziert Sustainable Switzerland exklusiv kuratierte Inhalte aus Medien der NZZ. Abonnemente der NZZ entdecken.
Dieser Artikel behandelt folgende SDGs
Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung, vereinbart von den UN-Mitgliedsstaaten in der Agenda 2030. Sie decken Themen wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, erneuerbare Energie, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Infrastruktur, Klimaschutz und den Schutz der Ozeane und der Biodiversität ab.
Werbung