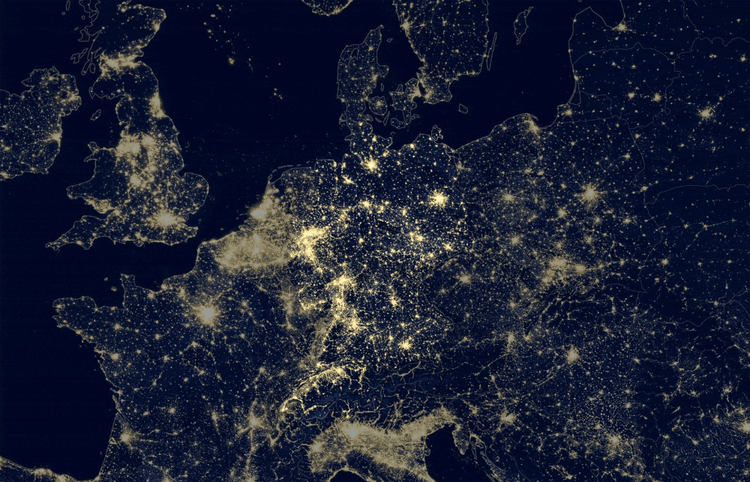Die Schweiz gilt als vorbildlich in Sachen Stromversorgung. Laut Schliesser lebt ein Schweizer Bürger im Schnitt mit gerade mal zehn Minuten ungeplantem Stromausfall pro Jahr – «und damit ist die Versorgungssicherheit bzw. -qualität mit Strom auf einem enorm guten Niveau.» Doch die Energiewende bringt neue Herausforderungen: dezentrale Stromerzeugung, komplexere Netze und eine steigende Abhängigkeit von digitalen Steuerungssystemen.
Die Schweiz ist im Stromnetz dicht bebaut und, wie in vielen anderen Bereichen auch, stark ins internationale Netz integriert. Allein auf der höchsten Netzebene finden wir 6700 Übertragungsleitungen, 12 000 Masten, 147 Schaltanlagen – die kritische Netzknotenpunkte im Übertragungsnetz darstellen – und 41 Grenzleitungen. Über diese könnte im Ereignisfall Hilfe aus dem Ausland kommen – gleichzeitig besteht über die Grenzübergänge die Gefahr, dass ein Blackout kaskadiert und auch die Schweiz betrifft.
Wahrscheinlichkeit vs. Möglichkeit
Begrifflich gilt es das Blackout von einem Stromausfall zu unterscheiden. Letzterer ist lokal begrenzt auf der Ebene des Verteilnetzes und kann zeitlich von kurzer oder langer Dauer sein. Und: Die Wahrscheinlichkeit für einen Stromausfall lässt sich statistisch berechnen, in einer «Wiederkehrwahrscheinlichkeit». Ein Blackout hingegen betrifft das Übertragungsnetz und ist somit überregional. und ist oft Resultat einer Kette von Ereignissen, die möglich sind, aber eben nicht wahrscheinlich.
«Ein Blackout ist nicht ein wahrscheinliches oder unwahrscheinliches Ereignis, sondern es ist ein mögliches Ereignis – ein Szenario, das wir uns ausdenken können, eine Geschichte, wenn man es so plakativ sagen will», erklärt Schliesser.
Nochmals ein anderer Fall liegt vor, wenn Strommangellage herrscht, die vor wenigen Jahren auch in der Schweiz Thema war. Dabei handelt es sich um einen Stromengpass, auf den durch rollende, gezielte Abschaltungen des Stroms reagiert wird, so wie es momentan auch in der Ukraine gehandhabt wird.
Gefahrenlage
Das Problem beim Blackout ist, dass er – wenn er grossflächig und langanhaltend ist – zur Katastrophe werden kann. Das Schadensausmass steigt exponentiell an, je länger die Wiederherstellungsdauer der Stromversorgung dauert. Kritische Infrastrukturen sind auf zirka 72 Stunden mit Notstromversorgung eingerichtet, danach wird es auch für diese komplizierter.
Wie sicher ist also die Schweiz? Auf welche möglichen Gefahren muss sie sich vorbereiten? Schliesser nennt mehrere Risikofaktoren: zunehmende Extremwetterereignisse, überalterte Netzinfrastruktur – auch für die neuen (Klein-) Stromerzeuger mit privaten Solaranlagen, die bidirektionale Stromflüsse brauchen –, lange Lieferzeiten für kritische Komponenten, die veränderte geopolitische Lage und ein Cyberrisiko mit dezentralen Energieanlagen, die primär softwarebasiert sind.
Sicherheit ist, wie überall, mit Kosten verbunden und es gilt im öffentlichen Sektor wie im privaten Umfeld klug vorzusorgen. Der Notvorrat für daheim kann auch die offiziellen Stellen im Ereignisfall kritisch entlasten. Und die Wissenschaft untersucht den Fall in Spanien und Portugal intensiv, um einen Beitrag zu leisten, wie die komplexen Systeme unserer Energieversorgung eben auch resilient gestaltet werden können.