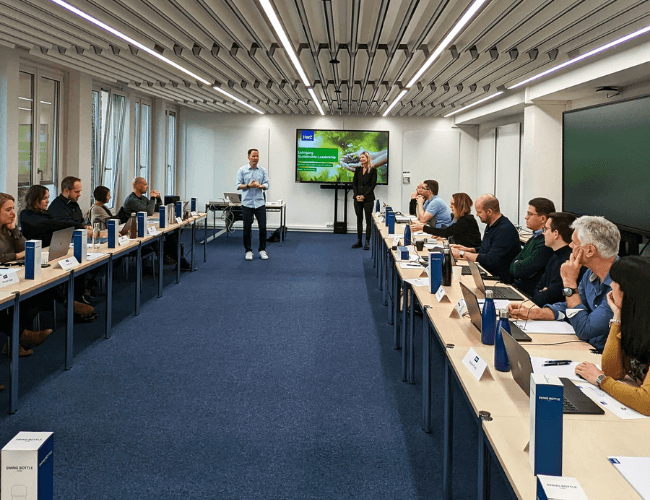Das Dach des Klassenzimmers ist der Himmel, der Pausenplatz der Dschungel. Im Physikunterricht bauen die Schüler Velos aus Bambus. Grammatik büffeln sie in der Hängematte. Im eigenen Gewächshaus wachsen Lebensmittel, die auf einem Herd gekocht werden, der mit Spänen aus einer lokalen Plantage befeuert wird. Glaubt man den zahllosen Artikeln und Reportagen, die über die Green School in Bali erschienen sind, macht diese Schule alles richtig, um den nächsten Generationen einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen mit auf den Weg zu geben, Hochschulanschluss inklusive.
Gegründet wurde die Green School im Jahr 2008 vom kanadischen Schmuckunternehmer John Hardy und seiner Frau Cynthia, die in den achtziger Jahren nach Bali kamen. Als die Kinder das schulpflichtige Alter erreichten, waren dem Paar die öffentlichen Schulen zu reaktionär und die internationalen zu elitär. Also beschloss es, seine eigene Schule zu gründen.
Mit einem guten Startkapital, einem ökologischen Versprechen und den Lehren Rudolf Steiners, die sie in den Dschungel trugen. Heute gibt es drei Ableger: in Neuseeland, Südafrika und Mexiko. Sie sind privat geführt und kosten die Eltern rund 15'000 Franken pro Studienjahr.
Besucht man die Homepage, staunt man. Tolle Sache, die Ausrichtung am Kindsbedürfnis, die Befreiung aus starren Lehrplanstrukturen, der Unterricht im Freien, das angewandte Lernen, aber auch die Sensibilisierung für Umweltfragen, die in den kommenden Jahrzehnten immer drängender werden dürften: Klimaerwärmung, Überbevölkerung, Ressourcenknappheit, Artensterben. Beim Klicken durch die Fotogalerie bemerke ich – typisch Mitteleuropäer – erst auf den zweiten Blick, dass die meisten Kinder weiss sind.
Exportprodukt Nachhaltigkeit
Eine Schule auf Bali, die mehrheitlich von europäischen, australischen oder amerikanischen Kindern besucht wird? Grund dafür sind die für balinesische Verhältnisse unerschwinglichen Gebühren, die sich fast nur Expats leisten können. Für Einheimische bleibt die Schule eine Utopie.
Ein Artikel in der «New York Times» bringt es auf den Punkt: «Was früher die Internate am Genfersee für die internationale Elite waren, ist heute die Green School in Bali.» Der Autor beschreibt die Eltern als «ranke Yoga-Mütter», die mit dem Latte-to-go-Becher in der Hand ihre Kinder vor dem Campus abladen. Man will nicht wissen, aus welchen SUV sie klettern. Nach Abschluss der Schule werden die meisten zurück in ihre Heimat fliegen; im Idealfall als vorbildliche junge Menschen, die Gutes tun. Nachhaltigkeit als Exportprodukt!
Aber brauchen wir dieses Ausfuhrgut überhaupt? Und ist das indonesische Versuchslabor auf andere Länder übertragbar, zum Beispiel auf eine öffentliche Schule in der Schweiz?
Googelt man die Stichworte «Lehrplan», «Schule» und «Ökologie», stösst man hierzulande schnell auf den Namen Regula Kyburz-Graber. Die Biologin ist emeritierte Professorin für Gymnasialpädagogik an der Universität Zürich und eine Pionierin der sogenannten «Umweltbildung». Sogar der Begriff stammt von ihr, weil sie sich stets gegen das Unwort «Umwelterziehung» stemmte. Da schwinge der moralische Zeigefinger mit, sagt sie am Telefon. Und mit Moral lässt sich kein Umdenken erzwingen.
Was sie am Modell der Green School Bali positiv bewerte, sei der ganzheitliche Unterricht, der von einer ganzen Schule getragen werden müsse, damit Umweltbildung funktioniere: weg von der Atomisierung des Stundenplans in Fächer und Lektionen, hin zu langfristigen Themenblöcken, die das Spektrum des Lehrplans widerspiegeln; von Mathe und Sprache bis zum technischen Gestalten oder Sachunterricht.
«Der Whole School Approach ist der richtige Weg, um etwas zu bewirken, und zwar von der Primar- bis in die Mittelschule», sagt Kyburz-Graber. «Doch wenn davon nur eine ausgewählte Klientel profitiert, wie etwa in Bali, dann findet keine gesellschaftliche Transformation statt. Von daher eignet sich die Green School kaum als gutes Beispiel für eine öffentliche Schule.»
Schön und gut, aber zu komplex?
Als 1972 der Club of Rome in seinem Bericht zur «Lage der Menschheit» die Folgen des ungebremsten Wirtschaftswachstums aufzeigte, unterrichtete Kyburz-Graber an einer Mittelschule. Sie war alarmiert und beschloss, das Thema Umweltschutz in den Unterricht zu integrieren. Ihre Kollegen («damals nur Männer») meinten, die Idee sei schön und gut, aber zu komplex für die Mittelschule. «Ich nahm mir vor, das Gegenteil zu beweisen.» 1978 schrieb sie eine vielbeachtete Dissertation über «Ökologie im Unterricht».
In den folgenden Jahrzehnten ist viel passiert, auch dank Regula Kyburz-Graber. Das Thema Ökologie ist heute unter der Leitidee «Bildung für nachhaltige Entwicklung» (BNE) im Lehrplan 21 verankert. Dort heisst es etwas vage: «Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Bedeutung von natürlichen Ressourcen und deren Begrenztheit auseinander. Sie befassen sich mit technischen und naturwissenschaftlichen Entwicklungen und denken über deren Einfluss auf Mensch und Umwelt nach.»
Noch fehlt es an Studien, die zeigen, wie sich das neue Kompetenzgebiet BNE im Schulalltag niederschlägt. Ein paar Anrufe bei befreundeten Lehrerinnen und Lehrern zeigen: Das Interesse besteht, auch ein Bewusstsein dafür, dass angesichts der ökologischen Herausforderungen die Schulen in der Pflicht stehen. Aber die Umsetzung der Lernziele scheitert oft daran, dass viele das Gefühl haben, ohnehin schon für alles verantwortlich zu sein.
Andere, die den Wortlaut in Sachen BNE beim Wort nehmen, sehen sich als Einzelkämpferinnen. Corinne Masur unterrichtet in Solothurn auf der Sekundarstufe 1 und sagt: «Der Lehrplan 21 bietet viele Möglichkeiten, Umweltthemen zu behandeln. Es gibt auch gute Weiterbildungsangebote. Aber verbindlich sind sie nicht. Es hängt vom Engagement der einzelnen Lehrperson oder der Schule ab, ob diese wahrgenommen werden oder nicht.»
Vorbild Dänemark: Draussen unterrichten
Rolf Jucker kennt das Problem. Der Bildungsexperte ist Leiter der Stiftung Silviva, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Lernen in und mit der Natur. Er beschäftigt sich seit fast zwanzig Jahren mit der Frage, wie Ökologie und nachhaltiges Lernen in den Schulalltag integriert werden können.
Die Lösung liegt für ihn vor der Tür: Silviva hilft Lehrerinnen und Lehrern, noch lieber ganzen Schulgemeinden, einen Teil des Unterrichts nach draussen zu verlegen. Dabei lohne es sich, statt nach Bali einen Blick nach Skandinavien zu werfen, sagt Jucker. In Dänemark unterrichten bis zu 35 Prozent aller öffentlichen Schulen etwa einen Tag pro Woche im Freien.
«Die Lernforschung zeigt, dass sich die Naturerfahrung positiv auf das akademische Lernen, die Kreativität, Gesundheit sowie die soziale Interaktion auswirkt. Schon ein Vormittag pro Woche zeigt Wirkung.» Wo das strukturell nicht möglich sei, bringe es bereits etwas, den Mathematikunterricht ab und zu in den Stadtpark zu verlegen. Das sei niederschwellig und kostengünstig. Ein geschärftes Bewusstsein für die Umwelt bekommen die Schüler auf diese Weise quasi gratis mitgeliefert.
Einmal die Woche raus? Das scheint keine unüberwindbare Hürde zu sein, dem Fernziel einer Schweizer Green School näher zu kommen. Trotzdem hat sich in der Schweiz noch nicht einmal ein halbes Dutzend Schulgemeinden dazu entschlossen, dem Draussenunterricht eine Chance zu geben.
Warum so wenige? «Weil viele Schulen und Lehrpersonen nicht wissen, wie sie ihren Handlungsspielraum, den ihnen der Lehrplan 21 ermöglicht, nutzen sollen», sagt Rolf Jucker. «Oft besteht das grösste Hindernis darin, dass man gar nicht erst versucht, sich auf eine Veränderung einzulassen.»