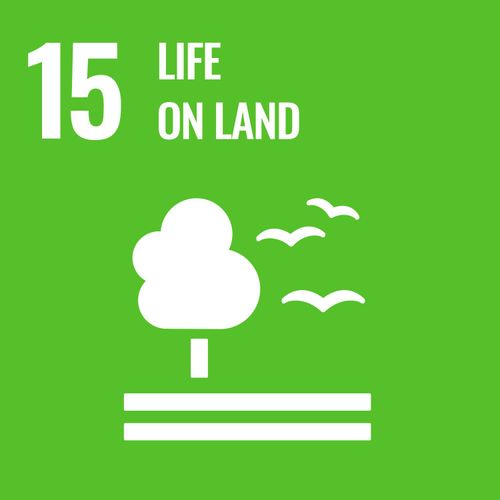Europa und viele andere Regionen auf der Erde haben immer öfter mit Rekordtemperaturen, Trockenheit und Wassermangel zu kämpfen. Das erhöht die Waldbrandgefahr.
Durch die Brände werden nicht nur Bäume und Gebäude zerstört. Auch Russpartikel und giftige Gase wie Kohlenmonoxid und Stickoxide sowie CO2 werden freigesetzt, die der Gesundheit schaden und den Klimawandel weiter anheizen.
In der Europäischen Union beträgt die Gesamtfläche der Wälder und anderer Waldgebiete etwa 160 Millionen Hektaren. Das entspricht knapp 40 Prozent der gesamten Landfläche der EU. Waldbrände sind an sich nichts Neues, aber sie setzen längst nicht mehr nur klassischen Waldbrandländern im Süden Europas zu. Auch Regionen in Zentral- und Nordeuropa sind zunehmend betroffen. Laut dem Europäischen Waldbrandinformationssystem kommt es in der EU jedes Jahr zu mehr als tausend Waldbränden, sie zerstören durchschnittlich 353 000 Hektaren pro Jahr.
Welche Faktoren begünstigen Waldbrände?
Damit ein Wald brennt, müssen generell mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss genug brennbares Material geben, ausreichend Sauerstoff – und genug Zündenergie.
Feuer werden in Europa und in vielen anderen besiedelten Regionen fast immer von Menschen verursacht, durch unvorsichtiges Verhalten oder auch Brandstiftung. Lagerfeuer, die nicht gelöscht wurden, oder weggeworfene Zigaretten können Feuer entfachen. Daneben können auch Stromleitungen Funken erzeugen, durch welche trockene Grashalme oder Zweige Feuer fangen. Es gibt auch natürliche Ursachen, vor allem Gewitterblitze können Brände verursachen.
Auch der Klimawandel wirkt bei Waldbränden im Hintergrund. Die Erwärmung und die Zunahme der Trockenheit tragen zu einer grösseren Intensität der Brände bei, und sie erhöhen die Brandgefahr. Die Saison, in der es brennen kann, wird länger. Der Anteil brennbaren Materials in den Wäldern nimmt zu.
An den natürlichen Voraussetzungen für Brände können die Menschen nichts ändern, etwa an der Trockenheit oder dem Terrain. Doch bei dem Zündstoff und den menschengemachten Ursachen – dazu gehören die für Feuer anfällige Vegetation, Gebäude oder der Zustand von Stromleitungen – kann man eingreifen, um künftige Brandkatastrophen zu verhindern oder einzudämmen.
Welche Rolle spielen Brände für den Wald?
Waldbrände zwingen Tiere zu fliehen, Pflanzen verbrennen. Aber die Feuer haben auch positive ökologische Auswirkungen. Wälder sind oft auf sie angewiesen.
Das Feuer vernichtet Biomasse, auch Krankheitserreger, und es zerstört viele chemische Substanzen, die sich im Boden angereichert haben und zum Teil toxisch auf die Vegetation wirken. Der Boden wird geradezu sterilisiert. Dadurch erhält die Natur die Chance für einen Neustart, ein Brand leitet die Waldverjüngung ein.
In Lichtungen können sich neue Pflanzen ansiedeln, oft erhöht sich die Artenvielfalt. Die Zapfen vieler Nadelbäume können sich nur unter diesen Bedingungen öffnen und die Samen erst dann keimen, wenn sie einmal der Hitze eines Waldbrands ausgesetzt waren. Diese Arten sind also für ihren Fortbestand auf Waldbrände angewiesen.
Wie werden Waldbrände bekämpft?
Forscher warnen davor, dass die Feuer in Europa zunehmend schwerer zu kontrollieren seien. Das führt dazu, dass Löscheinheiten vor Ort überfordert und von internationaler Hilfe abhängig sind, um die Brände zu bannen.
Diese Probleme betreffen nicht nur die klassischen Waldbrandländer im Süden Europas, sondern auch Länder in Zentral- und Nordeuropa. Wenn es aber in verschiedenen Regionen gleichzeitig und länger brennt, wie es heute der Fall ist, wird es schwieriger, die begrenzten Ressourcen aufzuteilen. Es braucht verstärkte und koordinierte Zusammenarbeit. Die EU hat vor zwei Jahren ein neues Programm eingeführt, um den gefährdetsten Ländern in der alljährlichen Waldbrandsaison mehr Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.
Zum Löschen von Feuern werden nicht nur Feuerwehr-Einheiten am Boden eingesetzt, sondern auch Helikopter und Löschflugzeuge, um die Brände aus der Luft einzudämmen.
Um Waldbrände zu stoppen, werden darüber hinaus Schneisen gezogen: Man befreit einen Streifen Wald von allem brennbaren Material oder feuchtet ihn so stark an, dass der Brand dort aufgehalten wird. Solche Schutzzonen helfen, die Intensität von Feuern zu mindern. Das ermöglicht es Löscheinheiten, die Feuer zu bekämpfen. Aufnahmen mit Infrarotkameras helfen, übrig gebliebene Glutnester aufzuspüren.
Feuerwehrleute fordern, dass die Bekämpfung von Vegetationsbränden auch in zentral- und nordeuropäischen Ländern mehr Aufmerksamkeit bekomme. Es gebe Verbesserungsbedarf bei der Schutzausrüstung für die körperlich harte Arbeit im Freien. Und es brauche geländegängige Fahrzeuge. Vor allem aber fordern Experten abgestimmte Einsatztaktiken und den verstärkten Austausch in Europa. Beides soll sicherstellen, dass der Einsatz verschiedener Einsatzkräfte reibungsloser ablaufen kann.
Aus welchen Gründen werden Waldbrände zu Katastrophen?
Die Flammen werden besonders dort zum Problem, wo der Wald und menschliche Siedlungen aufeinanderstossen: im sogenannten Wildland-Urban Interface (WUI).
In Siedlungen sind Grünanlagen und Gebäude potenzielles Brennmaterial. Holzzäune, Büsche und Bäume können alle zu Zündstoff werden. Auf steilen Hängen können sich Brände zudem schnell ausbreiten. Feuer können auf den nächsten Garten oder das nächste Haus überspringen – wenn es der Brennstoff zulässt.
Zudem erhöht sich bei starkem Wind die Gefahr, dass sich die Flammen zu einem Inferno entwickeln. Glühende Asche kann neue Brände entfachen. Beispielsweise können Palmen zahlreiche Glutpartikel produzieren, welche der Wind kilometerweit verweht.
Ein spezielles Problem stellen leicht brennbare Baumarten in den Wäldern dar. In Portugal und Spanien wurden viele Jahre lang Eukalyptusbäume angepflanzt, weil sich das Holz als Exportprodukt schnell bezahlt macht. Aber auch Pinien können explosionsartig verbrennen. Ein ähnliches Problem gibt es in Norddeutschland. Dort wurden in der Vergangenheit grosse Mengen Kiefern und Fichten angepflanzt. In Brandenburg kann die Landschaft aus Kiefernwäldern und Heide bei Dürre zu einem Pulverfass werden.
Wie schützen wir uns vor Waldbränden?
Nur mit Feuerwehreinsätzen lässt sich die Gefahr durch Waldbrände nicht bannen. Die intensiveren Brände haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Feuerwehrleute in Europa mit dem Löschen an ihre Grenzen stossen.
Forscher wie auch Feuerwehrleute sagen aus diesem Grund, es brauche die Mitarbeit von Forst- und Landwirten, Planern, Politikern, Bewohnern und Waldtouristen, um sicherzustellen, dass Brände sich nicht jedes Mal zu einer Katastrophe entwickelten.
In den meisten Ländern ist der Mensch der Hauptverursacher von Waldbränden. Darum sind Verhaltensänderungen ein zentraler Baustein der Prävention. Die Menschen müssen vor allem in Landschaften mit leicht entzündlicher Vegetation mehr Vorsicht walten lassen.
Das steigende Brandrisiko muss stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. Dazu gehören nicht nur verstärkte Warnungen vor Brandgefahr, sondern auch Feuerverbote. Vorsätzliche Brandstiftung muss geahndet werden. Ein gut ausgebautes Informations- und Warnsystem ist unerlässlich.
Forscher fordern auch die Umgestaltung von Wäldern zu mehr Mischwäldern. Ein naturnaher Waldbau gilt langfristig als nützliche Präventionsmassnahme. Mehrere Generationen von Bäumen und viele verschiedene Arten helfen dabei, die Brandgefahr zu vermindern, weil die Mischung für grössere Feuchtigkeit sorgt. Monokulturen hingegen können für Brände anfälliger sein.
Zudem braucht es mehr Brandschneisen und Pufferzonen vor Ortschaften – ohne totes Holz, ohne Äste am Boden oder andere Pflanzen –, um die Intensität der Flammen zu mindern. Im Frühjahr etwa könnten kontrollierte Brände gelegt werden, um Platz zu schaffen und feuerfangende Gräser und Sträucher zu entfernen.
Auch müssen Siedlungen und Häuser besser gegen die Brandgefahr gewappnet werden. Glühende Asche sammelt sich bei Wind oft an einem Ort: zwischen den Brettern einer Terrasse, in Spalten oder vor der Wandverkleidung sowie auf dem Dach. Auch können Funken in einen Lüftungsschacht fliegen und auf brennbarem Material landen. In einem Mulchhaufen kann die Glut gut schwelen und sich entzünden.