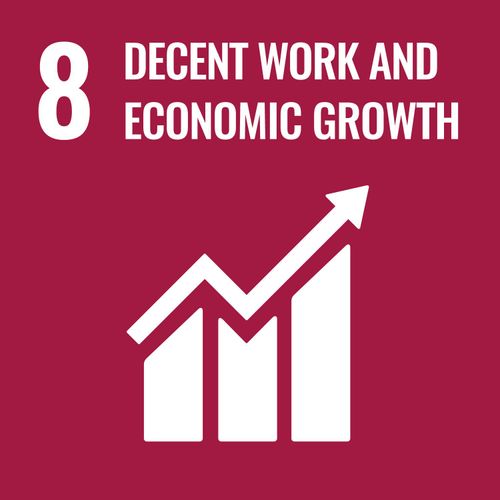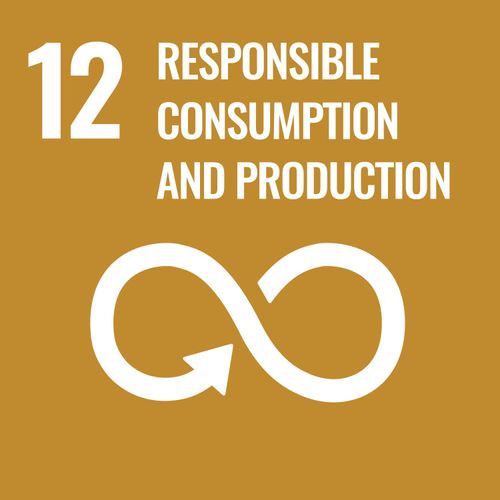Was können Industriestaaten bei diesem Thema tun?
Stahel: Die Industriestaaten müssen ihren Material- und Energieverbrauch um einen Faktor zehn, also um 90 Prozent reduzieren. Nur so ermöglichen sie es den Menschen in ärmeren Ländern, ihre Grundbedürfnisse in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Nahrung, Wohnen, Sicherheit und Mobilität befriedigen zu können, ohne die weltweite Masse an Infrastruktur und Gütern zu vergrössern.
Diese Masse an gefertigten Objekten hat bereits 2020 diejenige an Biomasse überholt. Nimmt die Masse an gefertigten Gütern weiterhin zu, schrumpfen Biodiversität und Biomasse auf dem Planeten Erde unaufhaltsam – mit katastrophalen Folgen für uns. In gleichem Umfang nimmt auch der weltweite Verbrauch an fossiler Energie und damit der CO2-Ausstoss zu. Denn diese Energie wird gemäss OECD und IEA mit fünf Billionen Dollar pro Jahr subventioniert, um die Transportwege der globalen Produktionswirtschaft zu verbilligen und Heiz- und Fahrzeugkosten sozial abzufedern.
Für die Schweiz hätte das Wirtschaften in Kreisläufen übrigens grosse Vorteile: Da wir über keine Ressourcen ausser Elektrizität verfügen, würde die Abhängigkeit von Importen stark abnehmen und damit die nationale Resilienz steigen.
Welche Rolle spielen kulturelle Faktoren bei der Kreislaufwirtschaft?
Stahel: Sie haben einen bedeutenden Einfluss auf unser Verhalten in Bezug auf Ressourcennutzung und Abfallvermeidung. Für den Einzelnen braucht es ein Umdenken im Sinne einer weitgehenden Beschränkung der Bedürfnisse und eines Verzichts. Auf nationaler Ebene ist Japan ein Leuchtturm dafür: «Mottainai» ist ein Lifestyle-Konzept, welches Bedauern für die Verschwendung von Ressourcen oder Besitz ausdrückt. Auch für Politiker gilt es umzudenken: Statt der Slogans «Net zero Carbon» und «Zero Ressourcenverbrauch», die nur bedingt erfolgreich sind, sollte es das Ziel sein, den Wert und die Nutzung eines Gutes möglichst lange zu erhalten. Kurzfristige Finanzplanung führt jedoch zu einer Vernachlässigung von Instandhaltungsarbeiten und später zu riesigen Ausgaben und enormen Risiken – man denke nur an Brückeneinstürze.
Was sind die grössten Hürden für Unternehmen beim Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft?
Stahel: Regulatorische Vorgaben zur Förderung der Industriegesellschaft behindern diese Wirtschaftsweise. Dazu gehören die Besteuerung von menschlicher Arbeit statt von Ressourcenverbrauch, die Erhebung von Mehrwertsteuern auch auf werterhaltende Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft oder die Zeitwertvergütung statt Realersatz bei Haftpflichtschadenfällen.
Es herrscht auch viel Unkenntnis in der BWL-Lehre, in Firmen und in der Beratung. So wird meist übersehen, dass die Aufarbeitung (Remanufacture) von Gütern einen fünfmal höheren Return on Investment (ROI) hat als die Fertigung derselben Güter. Zudem fehlen in der Wirtschaft entsprechende Compliance-Regeln.
Sie rufen die Verantwortlichen von Unternehmen zum Umdenken auf?
Stahel: Kreislaufwirtschaft ist disruptiv und braucht deshalb eine bewusste Abkehr der Geschäftsleitungen vom «Business as Usual». Es geht um eine Abkehr von der bisherigen Maxime möglichst tiefer Fertigungskosten zugunsten einer Kostenoptimierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die eigene Wettbewerbsfähigkeit wird durch tiefere Nutzungskosten gesteigert. Eine Modulbauweise mit standardisierten Komponenten verringert die Kosten und die Risiken in der Wartung von Gütern, die Ausbildungskosten des Personals sowie die Lagerhaltungskosten von Ersatzteilen – so hat es Airbus zum Beispiel vorgemacht. Es gibt gute Ansätze auch in zahlreichen weiteren Unternehmen.
Wo sehen Sie vielversprechende Innovationen in diesem Zusammenhang?
Stahel: Textilien sind das neue Plastik! Für die Rückgewinnung von Fasern aller Art, sei es Viskose, Wolle oder Baumwolle, werden in der Schweiz und in Europa laufend neue Technologien entwickelt. Das Unternehmen Climatex aus Altendorf im Kanton Schwyz hat ein Verfahren zur sortenreinen Trennung von Mischgeweben entwickelt. Anstatt wie 99 Prozent aller Textilien zum globalen Abfallproblem zu werden, gehen die Materialien von Climatex am Ende ihres Lebenszyklus zurück in ihren jeweiligen Kreislauf, um wieder und wieder verwendet zu werden. Mengenmässig sind jedoch Beton, Asphalt und Stahl die wichtigsten nichterneuerbaren Ressourcen. Heute fräst die Wirtgen Group, ein Baumaschinenspezialist, den Asphalt von Strassenbelägen und verwendet ihn für neue Deckschichten. Wichtig wäre in Zukunft zudem eine sortenreine Trennung von Stahllegierungen für ein grünes Stahlrecycling. Diese Trennung fehlt derzeit aber noch.
Ein weiteres Beispiel: Per Zufall haben Forscher der ETH Zürich ein neues, kreislauffähiges Polymer entdeckt: Polyphenylene methylene (PPM). Dieser fluoreszierende Kunststoff schützt Metalle vor Korrosion, repariert sich selbst und kann Schäden in der Schutzschicht durch Leuchten anzeigen.
Wo stehen wir in zehn Jahren in puncto Kreislaufwirtschaft?
Stahel: Die internationalen Vorgaben auf EUEbene wie der Critical Raw Material Act CRMA, neue ESG-Anforderungen, aber auch Strafzölle auf industriell gefertigte Produkte sowie Energie- und Materialressourcen verschaffen lokal tätigen Akteuren der Kreislaufwirtschaft einen finanziellen Vorteil gegenüber der globalen linearen Fertigung. Dieser positive Trend wird sich verstärken.
Künftig werden Unternehmen vermehrt Systemlösungen statt Produkte entwickeln. Startups werden ganz neue Lösungen auf den Markt bringen, wie etwa den Bau und Betrieb von Kühlräumen durch Leasing in ländlichen Gegenden Indiens durch die Basler Stiftung BASE. Insgesamt wird die Forschung auf dem Gebiet der zirkulären Materialwissenschaften zunehmen.