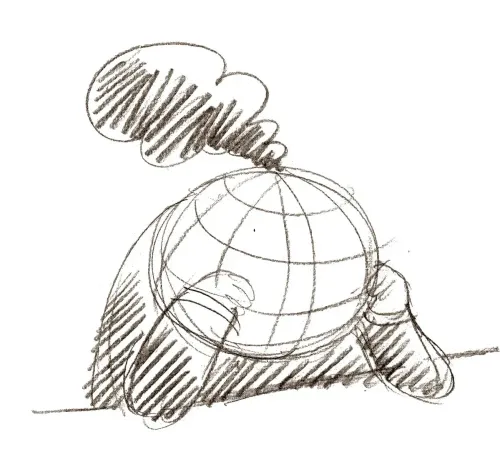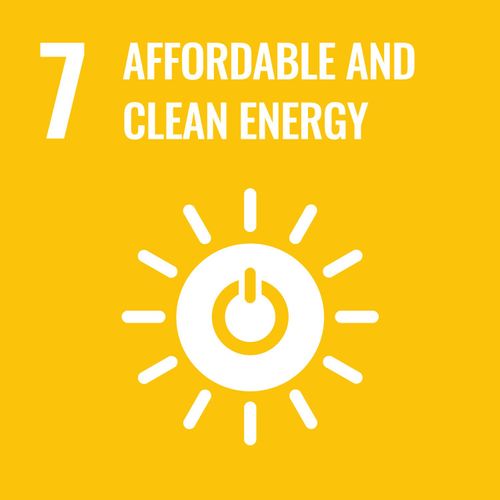Ursprünglich ausgerichtet auf die Reduktionsziele des Übereinkommens von Paris, hat das Positionspapier mit dem Krieg in der Ukraine und dem daran entzündeten energiepolitischen Konflikt zusätzlich an Bedeutung gewonnen. In der Grundaussage allerdings ändere sich wenig, erklärt Christian Schaffner, Geschäftsführer des Energy Science Center an der ETH Zürich und Mitverfasser des Positionspapiers: «Der Import von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl und dessen Reduktion stellt für die Schweiz in beiden Fällen eine enorme Herausforderung dar.»
Die Zahlen sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache: Allein 2020 nämlich importierte die Schweiz gemäss Zahlen des Bundesamtes für Energie rund die Hälfte ihres Energiebedarfs über fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Berücksichtigt man die importierten Kernbrennstoffe für die Stromproduktion in den Atomkraftwerken, bezieht das Land 72 Prozent seines Primärenergiebedarfs aus dem Ausland. Der grösste Teil des importierten Erdgases beispielsweise gelangt aus Deutschland über die europäischen Fernleitungen in die Schweiz. Deutschland seinerseits wiederum bezog bis vor kurzem rund 55 Prozent des Erdgases aus Russland. Eine heikle Situation also nicht nur für den nördlichen Nachbarn, sondern letztlich eben auch für die Schweiz. Angesichts der aktuellen energiepolitischen Entwicklung und mit Blick auf das klimapolitische Ziel, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, sei es denn wohl mehr als logisch, die Abhängigkeit von ausländischen Öl- und Gasimporten drastisch zu reduzieren, führt die Expertengruppe in ihrer Schrift aus.
Mehr Elektrizität für Verkehr
In ihrer Expertise kommen die ETH-Forschenden gleichzeitig zum Schluss, dass ein treibhausgasfreies Energiesystem für die Schweiz bis 2050 grundsätzlich machbar ist, sowohl von der technischen als auch von der wirtschaftlichen Warte aus gesehen. Ein Patentrezept allerdings gebe es nicht, betont Schaffner; «vielmehr beruht ein Netto-Null-Energiesystem auf einer vielfältigen Kombination von technischen, politischen und sozialen Massnahmen.» Zudem würden die Faktoren Kosten und Nutzen je nach Entwicklungspfad und Szenario sehr unterschiedlich ausfallen.
Den grössten Beitrag zur Senkung des Energiebedarfs und der Treibhausgasemission in der Schweiz orten die Wissenschaftler in der Elektrifizierung des Verkehrs. Er stellt aktuell einen Drittel des Energiebedarfs und ist einer der grössten Verursacher von Treibhausgasemissionen. Nebst dem Umstieg auf den öffentlichen Verkehr propagiert die Expertengruppe die Streichung von Strassennutzgebühren für Elektrofahrzeuge oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Wohngebieten, auf Firmenparkplätzen und entlang von Autobahnen, damit der Übergang zur E-Mobilität für die breite Masse attraktiv wird.
Ebenfalls grosses «Sparpotenzial» wird den Gebäuden zugeschrieben, dank dem Ausstieg aus Heizsystemen, die Öl oder Gas verbrennen. Gerade was die schleppend voranschreitende klimafreundliche und energieeffiziente Sanierung von Liegenschaften anbelangt, sollten die Rahmenbedingungen seitens der Politik stark verbessert oder die damit verknüpften Aktivitäten intensiviert werden, so die Studien-Verfasser. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine gleichmässige Aufteilung der Heizkosten auf Vermieter und Mieter oder eine national ausgelegte Strategie, welche den Austausch bestehender fossiler Heizungsanlagen ab dem Alter von 20 Jahren vorschreibt.
Weit schwieriger gestaltet sich der Ausstieg aus Erdöl und Erdgas in der Industrie. Um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Sektors nicht zu gefährden, sind langfristige Massnahmen erforderlich. Alternative Brennstoffe wie synthetisches Gas oder Wasserstoff kann zwar in den meisten Anwendungsbereichen das Erdgas ersetzen, sie erfordern aber einen Umbau der Produktionsanlagen, was logischerweise mit hohen Investitionskosten verbunden ist. Hier erachtet die Expertengruppe eine Kombination aus Fördermassnahmen (zum Beispiel Steuergutschriften) und Regulierungsmassnahmen (zum Beispiel Emissionsnormen für bestimmte industrielle Anwendungen) und die Förderung kohlenstoffarmer Alternativen wie grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe als vielversprechendste Lösung. Erdgas seinerseits sollte nur zusammen mit neuen «emissionsnegativen» Technologien verwendet werden, die CO2 abscheiden und speichern können.
Mit Unterstützung der Bevölkerung
Was die Akzeptanz der beschriebenen Massnahmen anbelangt, so ist diese in der Bevölkerung gross. Als Gradmesser dient eine Umfrage, die Mitherausgeber Anthony Patt, Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich, und seine Kollegen im April 2022 durchgeführt haben. Am wenigsten Zustimmung erntet demnach ein Verkaufsverbot von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2030 – und damit fünf Jahre vor dem von der EU geplanten Verbot. Am meisten Unterstützung hingegen geniesst der Ausbau von Wind- und Solaranlagen. «Insgesamt haben wir 1000 Stimmberechtigte befragt», führt Patt aus. «Von den zehn politischen Vorschlägen, die wir den Umfrageteilnehmenden vorgelegt haben, fanden deren acht bei der Mehrheit der Befragten volle Unterstützung.» Sogar einschneidende Massnahmen fänden vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs durchaus Mehrheiten für den Vollzug, konstatieren die Verfasser des Positionspapiers.
In ihrem Massnahmenkatalog führen die Forscherinnen und Forscher indes nicht allein technische Lösungsansätze an. Sie sind sich sicher: Damit die Schweiz ihre Versorgungssicherheit auch weiterhin aufrechterhalten kann, muss sie explizit internationale Vereinbarungen treffen. Denn eine «Insellösung» sei für das Schweizer Energiesystem weit ineffizienter und kostspieliger als der Austausch mit den Nachbarländern, so Christian Schaffner.
Die grösste Herausforderung auf dem Weg der Schweiz zu Netto-Null machen die Expertinnen und Experten der ETH Zürich letztlich nicht im technischen oder wirtschaftlichen Sektor aus, sondern in der Politik und der Gesellschaft. Selbst wolle die ETH zwar keine Politik machen, betont Anthony Patt; «aber wir können als Fachgremium die wissenschaftlichen Grundlagen liefern für Entscheide, welche die Politik dringend fällen muss.»