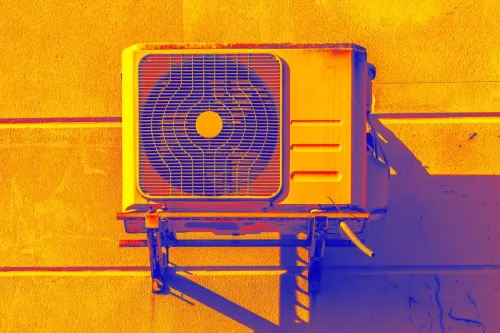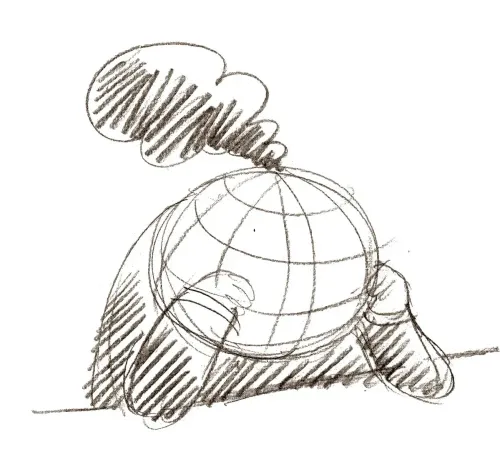Es gebe Pläne, den Bestand an Kernkraftwerken auszubauen, sagt Johnsson. Doch was die Umsetzung angeht, ist er skeptisch. Die Kernenergie sei kostspielig und mit langen Vorlaufzeiten verbunden. Die drei anderen europäischen Kernkraftwerkprojekte – in Grossbritannien, Frankreich und Finnland – hätten sich alle verzögert, und sie seien mit hohen Kostenüberschreitungen verbunden. Europa und Nordamerika seien es nicht mehr gewohnt, so komplexe Projekte wie den Bau eines Kernkraftwerks zu stemmen.
Es komme hinzu, so Johnsson, dass in Schweden wie auch in anderen europäischen Ländern inzwischen das Fachpersonal fehle, das man für den Bau eines Kernkraftwerkes brauche: «Viele Fachleute sind gestorben oder in Rente.»
Lehren aus den schwedischen Erfahrungen
Die grösste Herausforderung bei der Aufgabe, verschiedene Energiequellen miteinander in Einklang zu bringen, seien jedoch nicht technische Hindernisse, sondern solche wie Ideologie, soziale Akzeptanz und finanzielle Risiken, sagt Johnsson.
Für den Zuwachs an erneuerbaren Energiequellen sei es jedenfalls nötig, das Stromnetz in bestimmten Gebieten auszubauen, sagt McKenna vom PSI. Darüber hinaus könnten spezielle Überwachungstechnologien helfen, bestehende Trassen maximal auszulasten, ohne eine Überlastung der Leitungen zu riskieren.
Ausserdem braucht es Speicher, und zwar nicht nur solche für einige wenige Stunden. Sondern auch saisonale Speicher, die den Überschuss aus dem Sommer in den Winter retten. Beispielsweise könnten sogenannte Power-to-X-Technologien zum Einsatz kommen, die Strom in einen anderen Energieträger umwandeln, Wasserstoff zum Beispiel. Dieses Prinzip ist theoretisch für die Deckung der «Winterlücke» durch Stromerzeugung in Brennstoffzellen geeignet, leidet aber unter niedriger Effizienz und sehr hohen Kosten.
Falls der Stromüberschuss nur in Wärme umgewandelt werden solle, seien Wärmepumpen in Verbindung mit saisonalen thermischen Energiespeichern eine gute Technikkombination, sagt McKenna. Sie habe sich beispielsweise in Deutschland und Dänemark bereits bewährt.
Grundsätzlich denkbar ist es auch, dass die Nachfrage der Industrie nach Strom flexibler gestaltet wird. Diese Massnahme ist allerdings umstritten, auch weil man sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie macht. Besonders energieintensive Prozesse müssten auf angebotsreiche Stunden verlegt werden. Dafür braucht es finanzielle Anreize und eine geeignete Infrastruktur.
Das Stromnetz muss intelligenter werden
Eine wichtige Rolle, wenn man mehr Flexibilität in der Stromversorgung will, spielt auch das sogenannte intelligente Stromnetz (Smart Grid). Eine Idee ist zum Beispiel, dass Elektroautos an Ladestationen nicht nur Strom beziehen, sondern manchmal auch Strom abgeben, wenn sie gerade nicht zum Fahren gebraucht werden. Das könnte bei der Stabilisierung des Stromnetzes helfen. Die Geräte, die für das Smart Grid gebraucht werden, sind aber vielerorts noch nicht vorhanden.
Theoretisch könnten Privathaushalte ihren Strombedarf an das Angebot anpassen. Der Geschirrspüler würde dann vielleicht nachts laufen, wenn der Strom billig ist. Doch laut McKenna würden Privathaushalte derzeit nur sehr wenig Geld sparen, wenn sie flexibler bei der Stromnachfrage wären – vielleicht 30 bis 40 Franken pro Jahr. Derzeit seien nur wenige Menschen zu dieser Verhaltensänderung bereit.
Eine lokale Lösung könnten sogenannte Energy-Communitys bieten. Das sind lokale Energiegemeinschaften von Haushalten, die zu einem flexibleren Stromnetz beitragen, etwa indem sie einen gemeinsamen Energiespeicher nutzen. Zum einen ist das für den einzelnen Haushalt günstiger, weil ein grosser Speicher billiger ist als viele kleine. Zum anderen treten Synergieeffekte auf, weil sich die Nachfrage nach dem Strom wie auch das Angebot – über die gesamte Energy-Community betrachtet – zeitlich besser verteilen.
Eine Herausforderung ist die lokale Ebene der Verteilnetze
Auf der Gemeindeebene ist die Schweiz in den kommenden Jahren grundsätzlich gut auf die Aufgabe vorbereitet, das lokale Stromnetz flexibler zu gestalten. Die Verteilnetze, welche den Strom lokal zu den Haushalten führten, seien hierzulande in der Regel überdimensioniert, sagt McKenna. «Da steht der typisch schweizerische Gedanke dahinter, dass das Netz sehr robust sein soll.»
Mittelfristig allerdings, etwa bis 2035, könnten zusätzliche Energiequellen wie Photovoltaik oder eine zusätzliche Nachfrage, zum Beispiel durch Elektroautos, häufiger zu Problemen im Netz führen. Das bedeutete jedoch laut McKenna nicht gleich, dass das Netz instabil würde. Stattdessen verzögerte sich der Netzanschluss so lange, bis man die Netzinfrastruktur erweitert hätte.
Für die Netzbetreiber wäre es allerdings auch ein Problem, wenn sie nicht mehr so gut planen könnten wie früher. Diese Entwicklung zeichnet sich bereits ab: Mancherorts sinkt die Nachfrage nach Strom lokal, weil Haushalte den selbst generierten Strom, zum Beispiel von einem Solardach, auch gleich selbst nutzen. Eine Herausforderung für die Zukunft wird ausserdem sein, genügend Fachkräfte für den Umbau des Stromnetzes zu finden.
Grundsätzlich findet McKenna, dass die Diversifizierung bei der Stromversorgung eine Stärke sei. Vor zwei Jahren hätten Kollegen vom PSI untersucht, wie es um die Versorgungssicherheit der nationalen Stromsysteme in Europa stehe. Frankreich habe da relativ schlecht abgeschnitten, weil dort die Kernenergie so dominant sei. Eine höhere Punktzahl erreichten Länder mit einer stärkeren Mischung der Stromquellen wie zum Beispiel Dänemark, Island, Schweden und die Schweiz.
Um ein Energiesystem mit netto null Emissionen zu erreichen, brauche man alle Massnahmen, die zur Verfügung stünden, sagt McKenna. «Schliessen wir einzelne Massnahmen aus, heisst das nur, dass wir noch mehr von den anderen brauchen.»