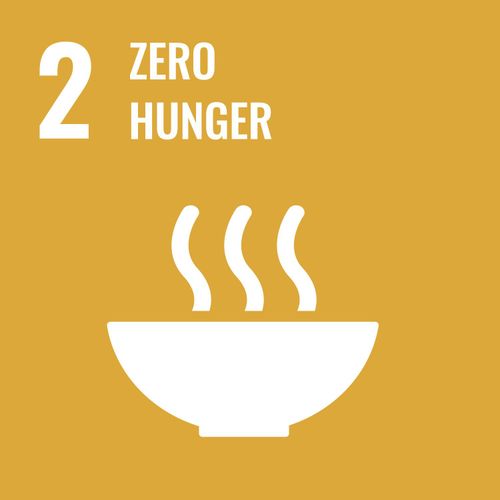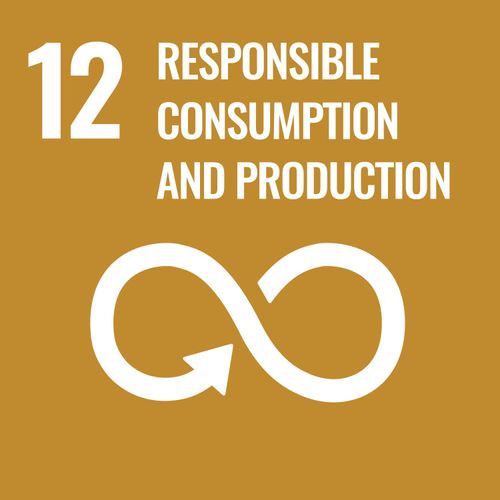Ob als Rösti, Pommes frites oder in Form der beliebten Zweifel-Chips: Die Kartoffel ist bei den Schweizern buchstäblich in aller Munde. Zurzeit läuft die Ernte, und die Prognose sieht gut aus. 453 000 Tonnen Erdäpfel dürften die hiesigen Bauern in diesem Jahr einfahren – deutlich mehr als 2024, wie Christian Bucher berichtet, Agronom und Geschäftsführer der Branchenorganisation Swisspatat.
Doch in Zukunft könnten grosse Schwierigkeiten drohen. Ein internationales, vom eidgenössischen Forschungszentrum Agroscope geleitetes Expertenteam sagt in einer aktuellen Studie signifikante Rückgänge bei der Schweizer Kartoffelproduktion voraus. Schuld sei der Klimawandel. Den Kartoffelpflanzen, botanisch Solanum tuberosum genannt, wird es zu warm, und auch die wechselhaften Niederschlagsmengen machen ihnen zu schaffen. Das sind schlechte Nachrichten für Landwirte, Industrie und Verbraucher.
Noch deckt die Schweiz rund vier Fünftel ihres Kartoffelbedarfs über die heimische Produktion ab. «Wir haben immer rund 20 Prozent Ertragsschwankungen», erklärt Christian Bucher. Laut den neuen Berechnungen der Agroscope-Forscher und ihrer Kollegen könnten die mittleren Erträge allerdings schon in den nächsten 10 Jahren um bis zu 15 Prozent sinken.
Für den Zeitraum 2050–2060 seien bei einer dem moderaten Szenario des Internationalen Klimarats (IPCC) entsprechenden Erwärmung Rückgänge von bis zu 37 Prozent zu erwarten. Sollten die Emissionen klimaschädlicher Gase ungebremst weitergehen und die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 3 Grad Celsius steigen, wären in 60 Jahren sogar Einbussen in der Kartoffelernte von knapp 85 Prozent möglich.
Die Flexibilität der Kartoffel hat Grenzen
Den Kartoffelexperten stand für ihre Prognosen ein einzigartiger Informationsschatz zur Verfügung. Seit 1990 führt die Agroscope an fünf verschiedenen Standorten in der Westschweiz jedes Jahr Anbautests mit unterschiedlichen Kartoffelsorten durch. Dabei werden alle relevanten Parameter wie Temperatur, Niederschlag, Sonneneinstrahlung und dergleichen exakt erfasst.
Die Versuchsfelder liegen in 420 bis 1200 Metern Meereshöhe und widerspiegeln so eine relativ grosse Bandbreite an lokalen Klimabedingungen. Zur Erkennung längerfristiger Trends analysierten die Wissenschafter die von 1990 bis 2021 gesammelten Daten und nutzten diese anschliessend für die Erstellung eines Vorhersagemodells.
Kartoffelpflanzen sind grundsätzlich recht anpassungsfähig, doch auch ihre Flexibilität hat Grenzen. Bei Temperaturen über 30 Grad gerät Solanum tuberosum leicht in Hitzestress. Das führt unter anderem zu einer gestörten Fotosynthese, wie die Agronomin und Mitautorin der besagten Studie Margot Visse-Mansiaux berichtet.
Übermässige Wärme beeinträchtigt die Aktivität wichtiger Enzyme; zusätzlich können die Membranen der Chloroplasten, welche praktisch die Generatoren der Fotosynthese sind, destabilisiert werden. «Das verringert die Kohlenstoffaufnahme und begrenzt so das Wachstum und den Ertrag», erklärt die Expertin. Der Knollenwuchs geht laut bisherigen Studien sogar schon bei über 19 Grad zurück, weil die Pflanzen dann mehr Ressourcen in ihre anderen Teile, wie Blätter und Blüten, investieren.
Der Klimawandel bringt in Mitteleuropa indes nicht nur eine Erwärmung, sondern auch eine Veränderung des Niederschlagsregimes mit sich. In den allermeisten Klimaszenarien bedeutet das: Es wird trockener. Während ihrer bis zu fünf Monate dauernden Wachstumsperiode brauchen Kartoffeln für eine gute Ernte zwischen 350 und 500 Millimeter Regen, was relativ viel ist.
Dürreperioden im Frühling führen zu verminderter Knollenbildung, in den vergangenen Jahren wurde die Schweiz schon mehrfach von solchen Trockenphasen heimgesucht. Andererseits lässt feuchtwarme Witterung bei Kartoffelpflanzen den Befall mit dem Pilz Phytophthora infestans ansteigen. Dieser löst die berüchtigte Kraut- und Knollenfäule aus. Überreichlicher Sommerregen schadet also auch.
Es braucht neue Sorten
Die Schweizer Landwirtschaft steht dem drohenden Kartoffelschwund zum Glück nicht völlig machtlos gegenüber. Der Anbau in tropischen Ländern wie Kenya kann hier gewissermassen als Vorbild dienen. «Eine Anpassung wäre möglich», meint Margot Visse-Mansiaux. Sie und ihre Kollegen empfehlen verbesserte Bewässerung, veränderte Pflanzzeiten und eine Verlagerung der Anbauflächen in höher gelegene, kühlere Areale.
Besonders wichtig wäre zudem der Einsatz von trockenheits- und hitzeresistenten Kartoffelsorten. Solche Massnahmen könnten die Folgen des Klimawandels abmildern, sagt Visse-Mansiaux. «Doch für einen kompletten Ausgleich wird es wahrscheinlich signifikante Investitionen brauchen.»
Christian Bucher sieht das ähnlich. Man versuche bereits jetzt, den drohenden Ernteeinbussen über die Sortenauswahl zu begegnen. Die Entwicklung entsprechend optimierter Varianten ist allerdings sehr aufwendig. «Es dauert heute 12 bis 15 Jahre, bis eine neue Kartoffelsorte auf dem Markt ist», erklärt der Agronom.
Der Hintergrund: Anders als zum Beispiel im Kampf gegen Krankheitserreger seien bei der Verbesserung der Hitzeresistenz sehr viele verschiedene Gene involviert, erläutert Bucher. Das erschwere die Züchtung nach herkömmlichen Verfahren. Swisspatat hoffe deshalb auf den Einsatz neuer Technologien, wie der Genschere Crispr-Cas9, deren Einsatz derzeit in der Schweiz im Gespräch sei. Diese würden auch die Bereitstellung angepasster Kartoffelsorten beschleunigen.
Eine gute Nachricht hält die Agroscope-Studie immerhin bereit: Der Stärkegehalt der Knollen scheint sich im Zuge der Erwärmung nicht wesentlich zu ändern. Das ist wichtig für die Qualität, vor allem bei der industriellen Verarbeitung, wie Margot Visse-Mansiaux betont. «Viel Stärke bedeutet festere Kartoffeln und bessere Backeigenschaften.» Die Chips dürften also auch in Zukunft gut schmecken, ob Klimawandel oder nicht.