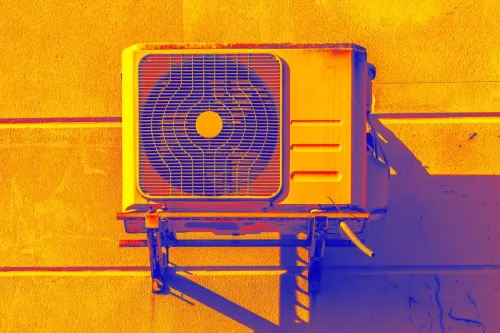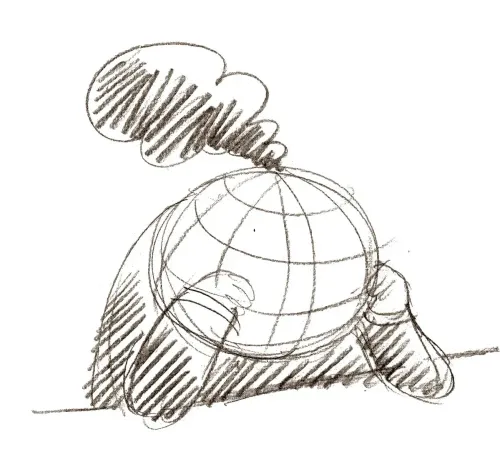Es sind diese Gegensätze, die sich auch bei den bisherigen Abstimmungen zu alpinen Solaranlagen zeigten. Gerade diese Einwände gegen Solarprojekte spornten Markus Balmer bei seinem Projekt an: «Die verschiedenen Ansprüche sind für mein Team und mich eine Aufforderung, nach besseren Lösungen zu suchen.» Um das Gleichgewicht zwischen schützenswerter Berglandschaft und dem ausgewiesenen Bedarf an erneuerbarer Energie zu finden, hat Balmers Team einen innovativen Ansatz entwickelt, der den unterschiedlichen Interessen gerecht werden soll.
BKW Ansatz geht auf Bedürfnisse ein
Markus Balmer ist überzeugt: «Wenn wir nichts ändern, können wir den Klimawandel nicht abbremsen.» Gerade der Alpenraum sei vom Klimawandel besonders betroffen. Dazu zählen der Rückgang von Permafrost und Gletschern, die Zunahme von Murgängen und die abnehmende Biodiversität. «Es wird nicht bleiben, wie es ist, auch wenn wir keine alpinen Solaranlagen bauen», bilanziert Balmer.
Die von der BKW speziell für alpine Solaranlagen entwickelte Lösung nimmt Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse. Die Solartische verfügen über einen zum Patent angemeldeten Klappmechanismus. Dieser ermöglicht es, dass die Anlage, trotz weniger Stützen und Fundationspunkte, den Schneedruck eines Jahrhundertwinters unbeschadet übersteht. «Bei zu hohem Schneedruck klappt die untere Reihe hoch und entlastet die Struktur », erklärt Balmer. «Zudem erlauben die grossen Stützenabstände von bis zu 7,5 Metern eine gute Zirkulation von Nutz- und Wildtieren innerhalb der Solaranlage.» Gleichzeitig erhofft sich der Betriebswirt der BKW weitere Vorteile. «Die grossen Stützenabstände verursachen – im Vergleich zu anderen Lösungen – bis zu 3,5-mal weniger Fundationspunkte pro alpine Solaranlage. Das wird sich auch in den Baukosten niederschlagen und führt zu weniger Eingriffen in die sensiblen Böden der Alpweiden.»
Erster Prototyp im Sommer
In diesem Sommer will die BKW den ersten Prototyp aufbauen. Dabei wird ein Solartisch von rund 20 Metern Länge und fünf Metern Höhe mit 32 Modulen errichtet. Ähnlich wie bei Holzschlagarbeiten am Steilhang werden temporäre Transportseilbahnen das Material anliefern. Auf diese Weise lassen sich viele Helikoptertransporte vermeiden. Sofern es die geologischen Bedingungen zulassen, werden die Stützen für die Unterkonstruktion im Abstand von 7,5 Metern direkt in den Boden geschraubt. Das schont den Boden und lässt sich bei Bedarf vollständig zurückbauen. «Wenn alles wie geplant funktioniert, stehen ab 2025 die Tische für den Bau der Anlagen zur Verfügung», freut sich Markus Balmer. Zuerst benötigt die BKW allerdings die Bewilligungen für die Solarprojekte im Kanton Bern.


 Markus Balmer, Head of Solar Development & Energy Solutions Schweiz bei der BKW
Markus Balmer, Head of Solar Development & Energy Solutions Schweiz bei der BKW