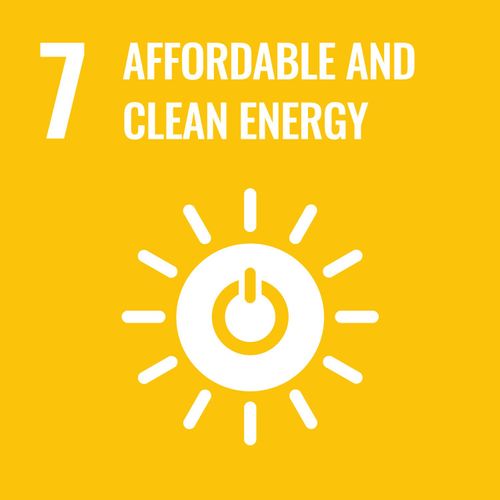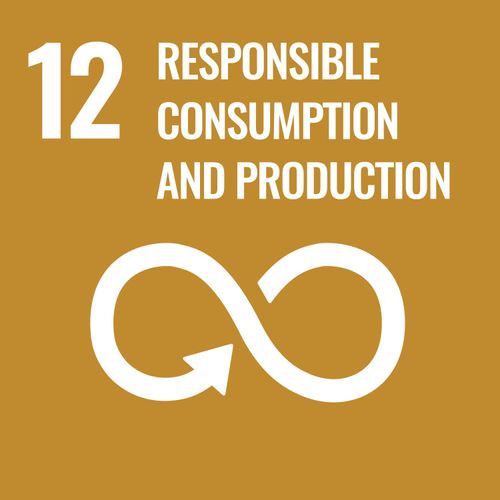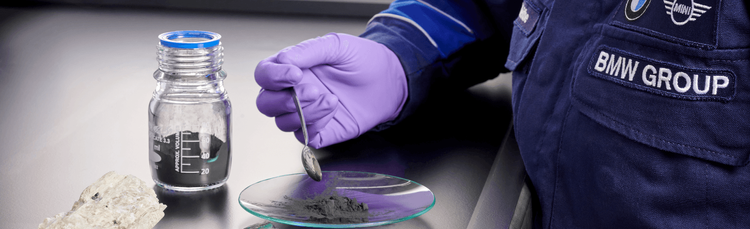Seltene Erden, Lithium, Kupfer – bei all diesen Rohstoffen ist Europa abhängig von Importen, oft aus China. Diese Woche hat Peking neue, und laut Experten die «bislang strengsten Exportkontrollen» für seltene Erden verkündet. Doch jetzt zeigen Forscher: Auch im Schweizer Untergrund schlummern viele der kritischen Rohstoffe.
Laut der Studie «Critical Raw Materials in Switzerland» finden sich hier Kupfer, Mangan und einige Elemente der seltenen Erden. Selbst Lithium, das als Schlüsselrohstoff für mobile Energiespeicher gilt, kommt vor.
Die Studie hat der ETH-Geologe Stefan Heuberger mit seinem Team für das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) verfasst. Sie stützen sich auf eine Rohstoffdatenbank, die geochemische Informationen aus drei Jahrhunderten versammelt: Diplom- und Doktorarbeiten, mineralogische Analysen von Bohrungen, Erkundungen für Eisenerzminen oder die Suche nach Uran. Entsprechend unterschiedlich ist die Qualität der Daten. «Es gibt grosse Lücken, denn nach den Rohstoffen, die heute als kritisch gelten, wurde nie strukturiert und schweizweit gesucht», sagt Heuberger.
Die Fundorte decken Muster auf
Wer beispielsweise die Karte mit den insgesamt 57 Fundorten von Kobalt oder Nickel anschaut, sieht lediglich den gegenwärtigen Stand des Wissens. Von vielen anderen Orten fehlen entsprechende Daten, womöglich gibt es auch dort Anreicherungen. «Man erkennt, dass die bekannten Vorkommen eng verknüpft sind mit bestimmten Gesteinen», erläutert der Geowissenschafter.
Beide Metalle sind auffallend häufig im Wallis gefunden worden, hauptsächlich in Gneisen des kristallinen Grundgebirges, die heute als sogenanntes Penninikum eine wichtige geologische Einheit der Alpen bilden. «Wer gezielt nach Kobalt oder Nickel suchen möchte, wird daher im Penninikum ansetzen.»
Die Studie sei als erster Überblick zu verstehen, sagt Heuberger, als Hinweis, wo weitere Erkundungen folgen müssten. Denn: Bei keinem der bekannten Vorkommen lohnt sich nach heutigem Wissensstand ein Abbau. Das hängt nicht nur vom Gehalt der gesuchten Elemente im Gestein ab.
Wenn die Rohstoffe zwar konzentriert vorliegen, aber es insgesamt nur eine kleine Menge gibt, könnte ein Bergwerk dennoch unrentabel sein. Auch die Lage der Rohstoffe spielt eine Rolle: Befinden sie sich nahe der Oberfläche und womöglich nahe an Strassen oder Schienen, lohnt sich ein Abbau eher, als wenn die Rohstoffe in unwegsamem Gelände und tief in hartem Fels lagern.
Um die vielversprechendsten Lokalitäten zu identifizieren, braucht es mehr Informationen. Dafür kämen drei wesentliche Methoden infrage, erläutert der ETH-Geologe. Erstens: viele Gesteinsproben sammeln – faustgrosse Stücke mit dem Hammer abschlagen und sie im Labor genau auf die Elementverteilung untersuchen. Zweitens: Sedimente in Flüssen auf die gleiche Weise analysieren. «Trägt man die Messwerte in eine Karte ein, kommt man dem gesuchten Vorkommen immer näher», sagt Heuberger.
Drittens: Fernerkundung. Auf Luft- und Satellitenbildern sind geologische Strukturen oft besser zu erkennen als vom Erdboden aus. Mit Spezialkameras werden Spektralanalysen vorgenommen, um die chemische Signatur der Oberfläche zu kartografieren. Diese chemische Signatur wird durch die Verwitterung des darunterliegenden Gesteins beeinflusst. Vorkommen von Erzen pausen sich sozusagen durch und hinterlassen ein charakteristisches chemisches Signal an der Oberfläche.
Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, die Anzeichen von Rohstoffvorkommen in den Daten aufzuspüren. «Solche Technologien sind, anders als Bohrungen, nichtinvasiv und weltweit ein grosses Forschungsthema», sagt Heuberger.
Akzeptiert die Bevölkerung den Bergbau?
Bis zu einem Abbau wäre es dennoch ein weiter Weg, nicht zuletzt der Mentalität wegen. «Wir wachsen auf mit dem Satz, die Schweiz habe keine Rohstoffe», kritisiert der Geoforscher. «Den muss man erst einmal aus den Köpfen bekommen.» Österreich mit ähnlicher Geologie habe durchaus Bergbau. In Mittersill beispielsweise befinde sich der grösste Wolframproduzent Europas.
Robert Moritz, Rohstoffexperte an der Universität Genf, ist skeptisch, ob sich die Situation in der Schweiz ändert. «Ich glaube, hier geht man eher davon aus, dass es woanders in Europa genügend Vorkommen gibt und sich die Suche hier nicht lohnt.» Für eine systematische Suche brauche es zudem ausländische Unternehmen, da es auf staatlicher Seite nicht genug Geologen gebe. Ein weiteres Hemmnis: Es mangele an zentralen Regularien für Bergbau. «Die Minengesetze sind in jedem Kanton anders», sagt er. Das mache es für ausländische Unternehmen allein auf administrativer Ebene sehr aufwendig, etwas aufzubauen.
Entscheidend wäre, eine Mehrheit in der Bevölkerung zu finden. Das ist schwer, wie ein ablehnendes Votum für ein Goldprojekt in der Surselva 2012 zeigte. Landschaftsschutz und Tourismus sind im Land sehr wichtig. Grosse Tagebaue hält Moritz daher für nahezu ausgeschlossen. Doch ein untertägiger Abbau sei denkbar. «Im Wallis und im Tessin gibt es viel Erfahrung mit Tunnelbau, wenn man dann noch das Beispiel Mittersill hinzuzieht, kann man schon die Unterstützung der Bevölkerung erhalten», sagt er. Umso mehr, wenn damit Einnahmen für die Region verbunden sind.
Neue Gewinnungsmethoden könnten das Akzeptanzproblem etwas entschärfen. Konkret geht es um Geothermiekraftwerke, die Wasser aus grosser Tiefe fördern, die Wärme «herausholen» und das Wasser dann wieder nach unten drücken. Mancherorts führt das kochend heisse und extrem salzige Tiefenwasser nennenswert Lithium. In Laborversuchen gelingt es bereits, das «weisse Gold» zu extrahieren.
In Deutschland und Frankreich wird intensiv daran geforscht, Lithium bald in industrierelevanten Mengen von mehreren Tonnen abzuscheiden. Der Oberrheingraben ist dabei besonders interessant. Nicht weit entfernt vom Bodensee zeigen zwei Bohrungen auf Schweizer Gebiet ebenfalls erhöhte Lithiumgehalte. Eine Gewinnung ist noch nicht vorgesehen. Je nachdem, wie die Technologieentwicklung im Ausland vorangeht, könnte sich das ändern.
Rohstoffe wiederverwenden statt neu abbauen
Ausser über geologische Rohstoffvorkommen verfügen die europäischen Länder auch über menschengemachte: Abfälle. Je besser sie aufbereitet werden, umso weniger Bergbau ist nötig, um den Bedarf zu decken.
Allerdings liegt die Rückgewinnungsrate von seltenen Erden in der EU bei unter drei Prozent, auch die Schweiz steht hier noch am Anfang. Das liege einerseits an den Kosten, sagt Victor Mougel, Professor am Laboratorium für Anorganische Chemie der ETH Zürich. «Die genannten Metalle werden hauptsächlich von China geliefert, und das relativ preiswert.» Recycling sei zudem anspruchsvoller als die Gewinnung aus Erz. «Es gibt viel mehr chemische Verbindungen, die berücksichtigt werden müssen, auch mehr Verunreinigungen», sagt Mougel. Die Technologien für die Rückgewinnung seien meist aufwendig und wenig effizient. Um wirklich grosse Schritte zu machen, brauche es mehr grundlegende Forschung.
Daran arbeiten Mougel und sein Team – und haben dabei eine neue Methode entdeckt, wie das Seltenerdelement Europium effizienter aus komplexen Gemischen abgetrennt werden kann. Exemplarisch haben die Forscher Europium direkt aus Leuchtstoffpulver von verbrauchten Energiesparlampen zurückgewonnen.
Von erfolgreichen Laborversuchen bis zu funktionierenden Industrieprozessen könne es durchaus acht bis zehn Jahre dauern, sagt der ETH-Forscher. Europa habe hier in letzter Zeit erkennbar aufgeholt und sei bei Forschungen zum Recycling von kritischen Rohstoffen vorn dabei, ergänzt er. Insbesondere Länder, die erfahren in der Aufarbeitung von Atommüll sind, spielen eine wichtige Rolle. «Die heutige Extraktion von seltenen Erden wurde aus Anreicherungsverfahren der Kerntechnik entwickelt.» Diese Länder, allen voran Frankreich, hätten gute Chancen, das Recycling seltener Erden auszubauen.
Doch auch die Schweiz ist laut Mougel gut aufgestellt. Neben der starken Forschung sieht er eine Bereitschaft der Menschen, etwas mehr zu zahlen, wenn ein Produkt «Swiss made» oder eben aus wiederverwerteten Abfällen hergestellt ist – und so das Land etwas unabhängiger von Importen macht.