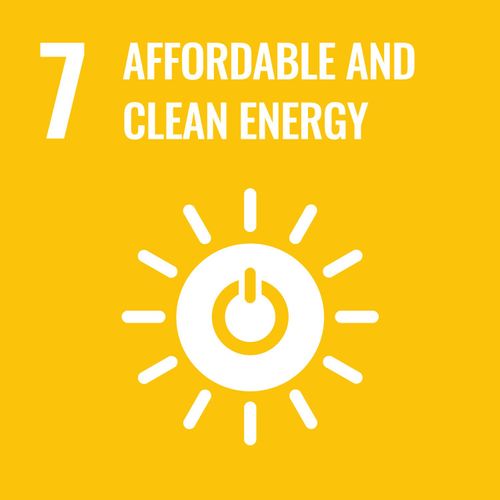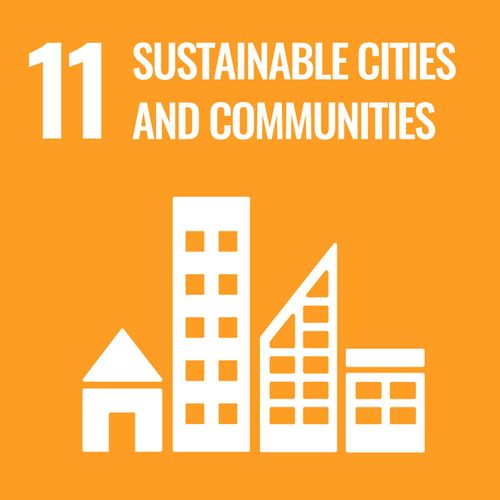Seit dem 9. Oktober steht fest: China nutzt seine Vormachtstellung bei der Herstellung und Verarbeitung von seltenen Erden als Waffe im schwelenden Handelskrieg zwischen Peking und Washington. Europa gerät dabei zwischen die Fronten.
Am Donnerstag verkündete Peking neue und laut Experten die «bislang strengsten Exportkontrollen» für seltene Erden und Magnete, die für Verteidigungstechnologien und in der Automobil- und Energiebranche benötigt werden.
Ab jetzt brauchen auch ausländische Unternehmen eine Genehmigung von Peking, um beispielsweise Magneten mit nur geringen Spuren chinesischer Bestandteile zu exportieren. Davon sind auch Unternehmen betroffen, die Halbleitertechnologien wie zum Beispiel Computerchips herstellen. Zudem treffen die Beschränkungen besonders Militärtechnologien hart: Unternehmen mit Verbindungen zu ausländischen Streitkräften würden weitgehend keine Exportlizenzen mehr erhalten.
China zementiert damit seine Dominanz über die seltenen Erden – mit sicherheits- und industriepolitischen Folgen für die USA aber auch für Europa. Schon im April kam der Schock für europäische Unternehmen: Damals hatte China Exportkontrollen einer Gruppe von seltenen Erden und Magneten verkündet – auch damals als Antwort auf die aggressive Handelspolitik der Donald Trump Administration.
Die europäische Industrie ist stark von China abhängig, die Beschränkungen haben Europa hart getroffen. Die Autoindustrie beklagte schon im Juni Produktionsstillstände. Die europäische Handelskammer in China warnte Mitte September von neuem, dass Unternehmen mit weiteren Stilllegungen und Verlusten rechneten.
Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Wie wichtig sind seltene Erden wirklich? Und kann sich Europa aus der Abhängigkeit von China befreien? Eine Einordnung mit Daten und Karten.
Warum braucht Europa seltene Erden?
Unter dem Sammelbegriff «seltene Erden» werden siebzehn Metalle zusammengefasst. Wegen ihrer ungewöhnlichen magnetischen und optischen Eigenschaften kommen sie für eine Vielzahl von alltäglichen Anwendungen zum Einsatz.
Beinahe alle moderne Technologie ist auf seltene Erden angewiesen. Sie stecken in Bildschirmen, wo sie eine hohe Auflösung ermöglichen und rote und blaue Farben strahlen lassen. Sie stecken in den dünnen, präzisen Linsen von Handykameras, im Katalysator von Autos, in Lautsprechern, Mikrofonen und Festplatten von Computern. Auch medizinische Technologie wie das MRT ist nur dank seltenen Erden möglich.
Auch in der Militärtechnologie werden seltene Erden an vielen Stellen verwendet. Radar, Nachtsichtbrillen, Raketentriebwerke, Laser-Zielfindung: Verschiedene seltene Erden sind in all diesen sicherheitsrelevanten Technologien verbaut. Ein Kampfflugzeug des Typs F-35 enthält etwa 500 Kilogramm seltene Erden. In militärischen Anwendungen ist die Abhängigkeit von seltenen Erden aus China besonders kritisch.
Die wohl am schnellsten wachsende Nachfrage nach seltenen Erden betrifft jedoch Magnete. Denn aus Eisen und der seltenen Erde Neodym können die stärksten und stabilsten Magnete hergestellt werden. Sie werden für viele elektronische Anwendungen gebraucht: für Festplatten und Lautsprecher – und für Elektromotoren.
Sie spielen deshalb für die Energiewende eine grosse Rolle. Die Umstellung der Automobilindustrie auf Elektromobilität und die Stromproduktion mit Windrädern erfordern grosse Mengen an Neodym-Magneten, die fast ausschliesslich aus China kommen.
Was erklärt die Abhängigkeit von China?
China kontrolliert 90 Prozent der Verarbeitung seltener Erden und ist für rund 70 Prozent der Förderung der entsprechenden Erze verantwortlich. Die EU importiert fast ihren kompletten Bedarf seltener Erden aus China – eine enorme geo- und industriepolitische Schwachstelle.
Chinas Dominanz ist kein Zufall, sondern die Folge einer industriepolitischen Strategie, die vor rund zwanzig Jahren ihren Anfang nahm. Ursprünglich hatten die USA ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Markt kontrolliert, im Jahr 1949 wurden grosse Vorkommen in Kalifornien entdeckt.
China erkannte jedoch bald den strategischen Wert der Rohstoffe. Das Land fing ab den 1960er Jahren an, eine eigene Industrie aufzubauen – ursprünglich, um die lokale Nachfrage nach seltenen Erden zu stillen. Unzählige Minen und Unternehmen wurden eröffnet, die Branche wuchs chaotisch. Das führte auch zu grossen Umweltschäden.
Ab den 2000er Jahren griff die chinesische Regierung zunehmend ein, räumte auf und richtete die Branche neu aus – inklusive eines Fokus auf Exporte. Während China in die Förderung und die Verarbeitung der Metalle investierte, sowie in die dafür benötigten Zulieferer und Maschinen, schrumpfte die Branche in den USA. Die wenigen Anlagen, die es in Europa gibt, dümpeln seit Jahrzehnten vor sich hin.
Denn seltene Erden abzubauen und zu verarbeiten, ist aufwendig, teuer und schmutzig – alles Faktoren, die Politiker in Europa Kopfschmerzen bereiten und die Bevölkerung gegen solche Projekte aufbringen. China dominiert weltweit auch, weil es die Metalle relativ kostengünstig verarbeiten kann.
Sind seltene Erden wirklich (so) selten?
Trotz ihrem Namen kommen seltene Erden in der Erdkruste relativ häufig vor. Die häufigste seltene Erde – das Element Cer – gibt es zum Beispiel öfter als Kupfer.
Beträchtliche Vorkommen an seltenen Erden befinden sich unter anderem in Vietnam, Brasilien, Australien, Russland, Kanada und Indien. Knapp die Hälfte aller weltweiten Reserven gibt es jedoch in China.
Diese Konzentration verschafft China einen geopolitischen Vorteil, weil es sonst wenige geballte Vorkommen von seltenen Erden gibt. Meist sind die Mengen zu klein, als dass der Abbau sich lohnte.
Seltene Erden kommen auch in Europa vor. In Schweden wurden beispielsweise im Jahr 2023 Vorkommen entdeckt. Im Jahr darauf wurde im Süden Norwegens eine der grössten bekannten Lagerstätten Europas gefunden. Das zuständige norwegische Unternehmen hat in Aussicht gestellt, mit den Vorkommen ab den 2030er Jahren bis zu 10 Prozent von Europas Bedarf an seltenen Erden decken zu können. Noch sind keine Minen in Betrieb.
Der Erfolg der Pläne hängt auch davon ab, dass eine vollständige Wertschöpfungskette vom Bergbau bis zum Magneten entsteht. Diese fehlt in Europa noch. Und das wird gemäss Hochrechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA) auch in den kommenden zehn Jahren eher so bleiben.
Denn gemäss den jüngsten IEA-Daten wird der Bergbau bis in die 2030er Jahre in wenigen Ländern konzentriert bleiben, auch wenn neue Akteure dazukommen. Unter anderem wird Australien vermehrt seltene Erden fördern. Bei der Verarbeitung wird China jedoch auch in zehn Jahren noch dominieren. Die IEA geht davon aus, dass das Land noch 2035 rund 80 Prozent der seltenen Erden herstellen wird.
Wie kann Europa eigenständiger werden?
Um sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien, gibt es für Europa grundsätzlich zwei Wege: einen grösseren Teil der Nachfrage nach seltenen Erden anderweitig decken oder seltene Erden durch alternative Materialien ersetzen.
Dafür muss Europa eine ganze Industrie neu aufbauen. Denn es braucht nicht nur den Abbau von seltenen Erden in Minen. Da verschiedene seltene Erden im Untergrund gemischt vorkommen, braucht es Anlagen, in denen das Erz in die verschiedenen seltenen Erden aufgetrennt wird. Und schliesslich müssen die einzelnen Stoffe zu Produkten wie Magneten weiterverarbeitet werden.
Ein Abbau von seltenen Erden wäre grundsätzlich an mehreren Orten Europas denkbar, ist aber bis jetzt noch kaum vorangeschritten. Erste Pilotprojekte gibt es in Schweden. In Lulea soll ein Industriekomplex entstehen, der aus einer bestehenden Eisenmine seltene Erden extrahiert. Bis 2026 soll dort eine erste Versuchsanlage funktionstüchtig sein. Darüber hinaus verhandeln EU-Diplomaten mit mehreren Ländern, die als Exporteure infrage kommen. Der Zugang zu den strategischen Rohstoffen spielt nun auch bei neuen Handelsverträgen eine zentrale Rolle.
Auch beim Auftrennen und Verarbeiten von seltenen Erden steht Europa ganz am Anfang. In diesem Frühjahr hat das Chemieunternehmen Solvay in La Rochelle in Frankreich eine bestehende Anlage erweitert, um seltene Erden aus Gemischen zu trennen und zu reinigen. Und Europas erste Fabrik für die Produktion von Magneten mit seltenen Erden wurde im September in Estland eröffnet.
Damit die Produktion seltener Erden in Europa wirtschaftlich mit China mithalten kann, fordern Unternehmen weitreichende Subventionen. Und um die Förderung in der Bevölkerung akzeptabel zu machen, braucht es eine Strategie zum Umgang mit den damit einhergehenden Umweltbelastungen.
Zusätzlich gibt es Bemühungen, gleich ganz ohne seltene Erden auszukommen – insbesondere in der Elektromobilität und der Windkraft, die auf grosse Mengen von Neodym-Magneten angewiesen sind.
Im Automobilsektor haben BMW, Renault und Nissan seit mehreren Jahren Autos mit Elektromotoren im Angebot, die ohne Permanentmagnete auskommen und damit auch ohne seltene Erden.
Und die EU finanziert bereits seit Jahren Forschungsprojekte, die starke und haltbare Magnete ohne Neodym und andere seltene Erden herzustellen versuchen. Wissenschafter entwickeln Magnete auf Basis sehr häufiger Elemente wie Mangan, solche aus Eisen und Stickstoff oder Eisen und Nickel. Noch sind diese den Neodym-Magneten unterlegen – sie sind entweder weniger stabil und weniger stark, oder sie sind schwieriger herzustellen. Doch wenn sich ihre Eigenschaften weiter verbessern lassen, machen sie einen grossen Teil der Importe aus China unnötig.
Wenn diese Forschungsprojekte Erfolg haben und ein Transfer des Wissens in die Industrie gelingt, lässt sich Europas Abhängigkeit von China langfristig dramatisch verringern.