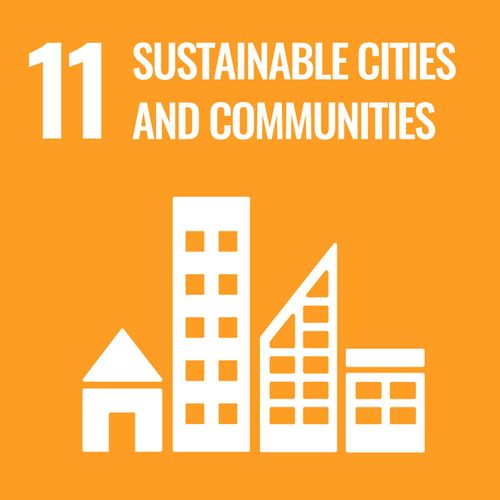Mit Angst und Bewunderung blickt der Westen derzeit auf China. Vor allem der strategische Weitblick, mit dem sich China in vielen Zukunftstechnologien eine Vormachtstellung erarbeitet hat, ist hierzulande Grund zur Sorge. Während Regierungen im Westen meist nur den nächsten Wahltermin im Blick haben, planen Chinas Genossen die Zukunft. Derzeit arbeitet die Führung in Peking am 15. Fünfjahresplan. Doch ein genauer Blick auf Chinas bisherige Pläne zeigt, was alles schiefgehen kann. Viele Fehlentscheidungen sind noch heute zu sehen und zu spüren.
«Der Grosse Sprung»: Mit Kochtöpfen zur Stahlmacht
Mit dem 2. Fünfjahresplan (1958–1962) wollte die Kommunistische Partei (KP) den «Grossen Sprung nach vorn» schaffen. Ziel war eine rasche Industrialisierung. Mao nannte die nationale Stahlproduktion als einen Gradmesser für eine erfolgreiche Modernisierung. So wurden 1958 die Zielvorgaben drastisch erhöht: Das Jahresziel sprang von zuvor 5,35 Millionen Tonnen (1957) auf 10,7 Millionen Tonnen. Grosses Ziel war es, binnen fünfzehn Jahren die industrielle Leistung der Stahlmacht Grossbritannien zu übertreffen. Kurzfristig sollte man jedoch zumindest die Sowjetunion einholen.
Mobilisierung «aller Hände»: Millionen Menschen, vor allem auch Bauern, wurden zum Stahlschmelzen mobilisiert. In improvisierten Öfen in Dörfern und Stadtvierteln wurden sämtliche Metallgegenstände eingeschmolzen – alles, von Schrott über Werkzeuge bis hin zu Besteck und Kochtöpfen. Befeuert wurden die Öfen durch eine umfassende Abholzung und das Verbrennen von Möbeln. Doch die meisten Produkte waren unbrauchbares Roheisen minderer Qualität.
Die Folgen waren verheerend: Die Arbeitskraft der Bauern fehlte auf den Feldern, die notwendigen Geräte waren eingeschmolzen worden, selbst in den Küchen fehlte es fortan an Töpfen zum Kochen. Der «Grosse Sprung nach vorn» endete in einer beispiellosen Hungersnot mit Millionen Toten.
Ein-Kind-Politik: Wachstum dämpfen
Die Ein-Kind-Politik wurde 1979 eingeführt und 1980 landesweit standardisiert; ihre strikte Umsetzung fiel in die Phase des 6. Fünfjahresplans (1981–1985). Ab 1983 kam es zu massiven Zwangsmassnahmen wie umfassenden Sterilisationskampagnen. Im 8. Fünfjahresplan wurde die staatliche Familienplanung schliesslich als «eine der drei grundlegenden Staatspolitiken» benannt.
Offiziell wurde die Ein-Kind-Politik als notwendige Massnahme dargestellt; man müsse das rapide Bevölkerungswachstum bremsen, da sonst das Wirtschaftswachstum, der Lebensstandard und die «Vier Modernisierungen» in Landwirtschaft, Industrie, Verteidigung und Wissenschaft/Technik gefährdet würden. Führende Politiker argumentierten, Chinas sehr grosse Bevölkerung und die begrenzte Ackerfläche seien die zentralen Hemmnisse auf dem Weg in eine glückverheissende Zukunft. Eine strikte Geburtenkontrolle solle deshalb die spärlichen Ressourcen schonen und den Pro-Kopf-Wohlstand erhöhen.
Führender Vertreter war unter anderem der Raketen- und Raumfahrtingenieur Song Jian, der in den späten 1970er Jahren seine Ideen auf die demografische Entwicklung Chinas übertrug. Seine Analyse: Sollte Chinas Bevölkerung in gleicher Geschwindigkeit wachsen, würde sie im 21. Jahrhundert auf weit über 2 Milliarden Menschen ansteigen. Das würde jedoch das erwirtschaftete Wachstum vollkommen aufbrauchen. Deshalb sei eine strikte Ein-Kind-Politik nötig, um die «optimale» Bevölkerungsgrösse zu erreichen. Als «ideale» Zielgrösse errechnete Song etwa 700 Millionen Menschen.
Die Folgen sind heute zu spüren: eine rapide Überalterung der chinesischen Bevölkerung mit all ihren Folgeerscheinungen wie mangelnder Altersversorgung sowie abnehmender Dynamik – und im speziellen chinesischen Umfeld ein massiver Überschuss an Männern.
Industrie-Cluster: «Jetzt verschmutzen, morgen putzen»
Der 8. Fünfjahresplan (1991–1995) stand im Zeichen einer zonengetriebenen Industrialisierung. Vor allem entlang von Flüssen sollten Chemie-, Textil-, Gerberei-, Elektro- und Metallbetriebe angesiedelt werden. Die Cluster-Bildung war das institutionelle Vehikel für den Aufbau einer exportorientierten Leicht- und Chemieindustrie.
Lokale Regierungen wurden durch Wachstums- und Einnahmenziele motiviert, solche kommunalen Industrie-Cluster aufzubauen. Im Fokus standen Wachstum und Entwicklung der eigenen Region, die unzureichende Abwasserbehandlung führte jedoch zu chronischer Gewässerverschmutzung durch Schwermetalle und organische Toxine. Man schien einer bizarren Logik zu folgen: «jetzt verschmutzen, morgen putzen». Die Bewässerung der umliegenden Felder, das Trinkwasser und somit ganze Nahrungsketten wurden kontaminiert.
In der Folge entstanden überall im Land «Krebsdörfer» (癌症村) – ein Begriff, den der chinesische Journalist Deng Fei prägte. Es handelt sich um kleine Gemeinden in der Nähe umweltverschmutzender Fabriken, in denen die Krebsraten weit über den Landesdurchschnitt stiegen. Chinesische Medien, Wissenschafter und NGO schätzten damals die Anzahl solcher Gemeinden auf mehr als 450, verteilt auf so gut wie alle Provinzen des Landes. Bekannte Beispiele waren Wuli in der Provinz Jiangsu, wo nach dem Bau der Nanyang Chemical Industry Zone im Jahr 1992 die Krebserkrankungen rapide zunahmen. Erst 2013 – in der Phase des 12. Fünfjahresplans – wurde überhaupt die Existenz solcher «Krebsdörfer» von offizieller Seite eingestanden.
Wachstum: Bitte mit Umweltschutz
Der 10. Fünfjahresplan (2001–2005) gilt häufig als treibender Faktor für die hohe Luftverschmutzung – obwohl man eigentlich klare Umweltziele vorgab. Zentrale Emissionen, beispielsweise von Schwefeldioxid (SO2) und Russ, steigen deutlich an, die Kohlenutzung verdoppelte sich. In dieser Phase zeigte sich ein anderes Problem mit den Fünfjahresplänen. Es gelang nicht, auf ungeplante Entwicklungen zu reagieren.
Die Energiepolitik des 10. Plans basierte auf Annahmen aus dem 9. Plan. Tatsächlich explodierten Investitionen und die Industrieproduktion (2003 stiegen die Investitionen um fast 30 Prozent), so dass der Energiebedarf stark über den Erwartungen lag; die Antwort war ein breiter Ausbau der Kohlekraftwerke.
Die Folgen: 2005 lagen Schwefeldioxidemissionen 42 Prozent über dem eigentlichen Planziel, bei Russ war man ebenfalls 11 Prozent darüber. China wurde gemäss den Daten der Weltbank zum grössten SO2‑Emittenten der Welt. Als Reaktion setzte die KP-Führung im folgenden Fünfjahresplan harte landesweite Minderungsziele für SO2 fest − minus 10 Prozent gegenüber den Werten aus 2005.
Doch noch Jahre später ist die Luftverschmutzung in China ein grosses Problem. Geräte zum Messen der Luftqualität wie auch Luftfilter gehören zur Standardausstattung in den Wohnungen der Mittelschicht. Der ärmeren Bevölkerung hingegen bleibt meist nichts anderes übrig, als auf starken Wind oder reinigenden Regen zu hoffen – beides senkt die dramatische Luftverschmutzung zumindest zeitweilig auf ein halbwegs akzeptables Niveau.
Urbanisierung: Bauen, bauen, bauen
Es war im 11. Fünfjahresplan (2006–2010), in dem die Parteigenossen zu dem Schluss kamen: Für die Entwicklung einer ausgewogenen Volkswirtschaft bedarf es einer schnellen Urbanisierung.
Die Folge war ein unkoordinierter Bauboom – riesige Wohn- und Gewerbekomplexe wurden errichtet, überdimensionierte Bahnhöfe aus dem Boden gestampft, vielerorts Flughäfen errichtet. Der Boom kannte kaum Grenzen, der tatsächliche Bedarf spielte eher eine nachgeordnete Rolle, wenn überhaupt.
So entstanden «einsame Flughäfen» wie in Luliang. Dort wurde für rund 160 Millionen Dollar ein Flughafen errichtet, an dem in den Folgejahren gerade einmal drei bis fünf Flüge pro Tag abhoben. Immer noch besser als das «Treiben» am Dachangshan Airport, wo nach einer millionenteuren Renovierung 2008 mit Passagierzahlen von mindestens 40 000 bis 80 000 Menschen gerechnet wurde. Fünf Jahre später waren es noch immer weniger als 4000 – das sind rund 10 Leute pro Tag. Inzwischen hat sich bei einigen dieser Projekte die Situation etwas verbessert, aber statt schnelles Wachstum zu erreichen, behindern sie eher die Entwicklung, weil Betrieb und Abschreibungen den Haushalt der jeweiligen Provinzen belasten.
Noch heute kann man bei Fahrten durch die Volksrepublik riesige Geisterstädte erkunden – dichtgedrängte Wolkenkratzer, die in den Himmel ragen und in denen kein Mensch wohnt. Nirgends brennt Licht, kein Mensch ist auf den Strassen, meist fehlen die Fensterscheiben. Schätzungen gehen von mindestens 65 Millionen leeren Wohnungen aus – das wäre genug für die gesamte Bevölkerung Frankreichs.