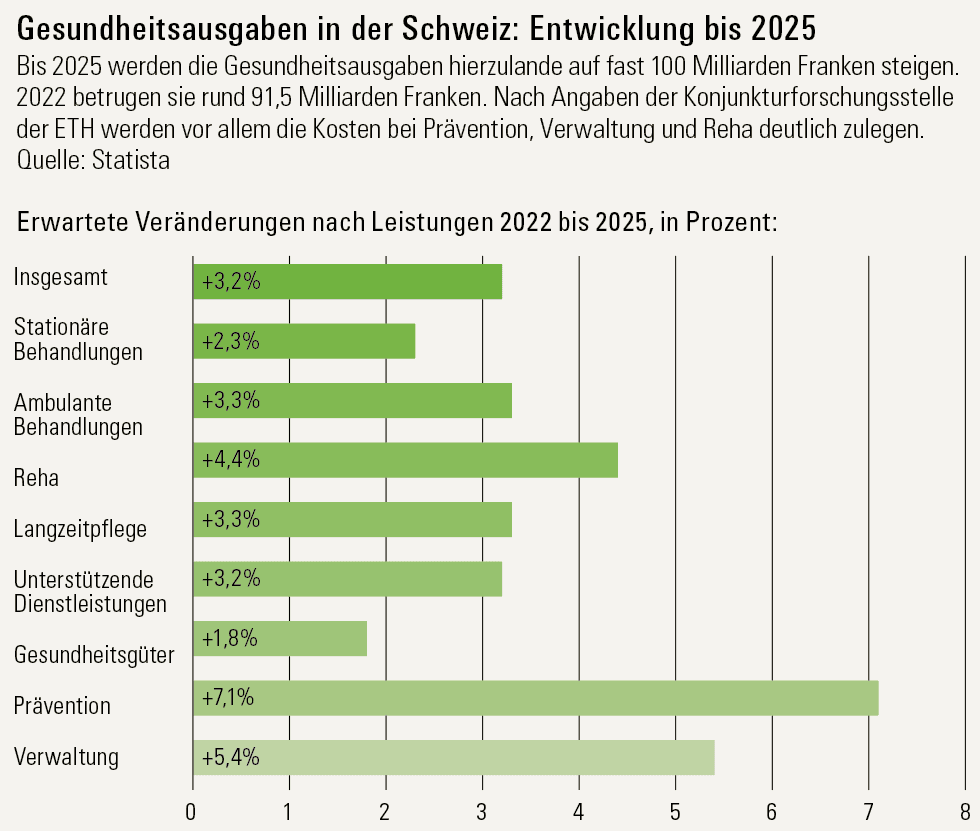Was macht die Politik, um die Einführung von E-Dossiers zu beschleunigen?
Wir haben im Parlament in der letzten Session einen Kredit bewilligt, der Anreize schaffen soll, dass mehr Patientendossiers eröffnet werden. Pro eröffnetem Patientendossier gibt es einen Beitrag des Bundes und des Kantons. Es ist ein Anreiz, um die Hürden der Anfangsinvestition etwas tiefer zu setzen. Die heutige Lösung überzeugt jedoch noch nicht, das hat auch der Bundesrat erkannt, der nun eine Überarbeitung vorschlägt.
Sie setzen sich speziell für die Bedürfnisse von Frauen im Gesundheitssystem ein, Stichwort Femtech. Was ist damit gemeint?
Die Bedürfnisse der Frauen im Bereich der Gesundheitsversorgung sind andere als jene der Männer. Dem hat man bis jetzt zu wenig Beachtung geschenkt, unter anderem in der Diagnostik. So können Frauen ganz andere Symptome aufweisen als Männer bei derselben Krankheit. Bei einem Herzinfarkt zum Beispiel sind die Symptome je nach Geschlecht unterschiedlich. Das kann dazu führen, dass das Krankheitsbild bei einer Frau nicht sofort erkannt wird.
Das Problem beginnt bereits in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte?
Ja, es wird in der Lehre zu wenig auf die Unterschiede der Geschlechter in der Medizin eingegangen. Das hat man erkannt, indem man zum Beispiel in Zürich jetzt einen Lehrstuhl für Gendermedizin eingerichtet hat, was eine sehr gute Sache ist. Aber nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung wird noch zu wenig in den Fokus genommen, dass zum Beispiel neu entwickelte Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedlich wirken können.
Worauf muss sonst noch der Fokus gelegt werden?
Auf die Innovations- und Forschungsförderung. Hier geht es darum, Projekte von Frauen für Frauen stärker zu unterstützen. Dahinter steht die Überlegung, dass man nicht die eine Hälfte der Bevölkerung aus dem Blick verliert.
Seit über einem Jahr sind Sie Präsidentin des Spitalverbands H+, des nationalen Spitzenverbands der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Im Interview mit der NZZ sagten Sie, dass die Spitäler, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und die FDP das gleiche Ziel hätten, nämlich die Kosten zu senken. Ohne Qualitätseinbusse natürlich. Inwiefern konnte dieses Ziel bereits umgesetzt werden?
Dies so rasch umsetzen zu können wäre ein hoher Anspruch. Aber wir haben die richtige Stossrichtung. Auch die Spitäler tragen die Forderung nach einer grossräumigeren überregionalen Gesundheitsversorgung mit. Zu denken ist an Versorgungsnetzwerke, welche es auch bereits gibt. Zudem beginnen die Spitäler, auch neue Modelle wie etwa «Hospital at Home» zu testen – eine Erweiterung der gängigen Pflege zu Hause: Patientinnen und Patienten werden nach einer Behandlung, die üblicherweise eine Hospitalisation erfordert, im häuslichen Umfeld therapiert. Auf diesem Gebiet hat die Schweiz, im Vergleich mit anderen Ländern, durchaus Nachholbedarf. Die Spitäler haben erkannt, dass es neue Wege für die Zukunft braucht.
Neuerungen verursachen meist auch Kosten. Greift die Politik den Gesundheitseinrichtungen dafür unter die Arme? Bietet sie Anreize, neue Wege zu beschreiten?
Klar ist für mich: Spitäler, die wirtschaftlich arbeiten und ihre Leistungen in der geforderten Qualität erbringen, müssen adäquat finanziert werden. Das ist leider aktuell nicht gegeben – ein Problem, das sich in den finanziellen Schwierigkeiten vieler Spitäler im Moment zeigt. Die Tarife, die wir heute haben, sind nicht kostendeckend, das muss sich ändern, und es braucht eine neue Tarifstruktur. Ansonsten kommt es zu einer willkürlichen Entwicklung der Spitallandschaft. Einzelne Spitäler werden subventioniert, andere nicht. Es sollte stattdessen eine Entwicklung der Spitallandschaft geben, die sich am Bedarf, an Qualität und Wirtschaftlichkeit orientiert.