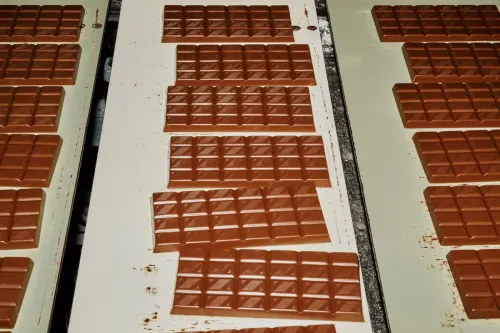Die Schweiz hat ein ähnliches Problem wie der Rest der Welt: Die Bevölkerung wächst – und die zusätzlichen Menschen müssen ernährt werden. Aber wie kann man mehr Lebensmittel produzieren, ohne der Umwelt zu schaden? Die Ökosysteme sind bereits heute unter Druck – vom Klima über die Biodiversität bis hin zu Gewässern und Naturlandschaften.
Streit um Biodiversitätsflächen
Im Konflikt zwischen Mehrproduktion und Umweltschutz gibt es eine neue Kampfzone: Wie viel Ausgleichsflächen sind nötig, um die Biodiversität zu wahren? Künftig soll es in der Schweiz laut den Plänen des Bundesrates mehr solcher Schutzräume für Tiere und Pflanzen geben. Aber das findet die Schweizerische Volkspartei (SVP) schlecht.
«Es braucht mehr Anbauflächen statt Brachflächen, Buntwiesen und Steinhaufen», sagte die SVP-Nationalrätin Esther Friedli, als sie letzten Sommer die Lancierung einer Volksinitiative ankündigte (die bis jetzt allerdings nicht erfolgt ist). Die Hauptforderung der Initiative lautet, dass die Schweizer Bauern wieder mehr produzieren sollten. Damit soll auch der sogenannte Selbstversorgungsgrad von heute 50 auf 60 Prozent steigen.
Zuwanderung verschärft Zielkonflikte
Ist eine neue Anbauschlacht der richtige Weg? «Wenn man mit den bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen mehr produzieren will, geht das nur, indem man Umweltziele opfert», sagt der Ökonom und Agrarexperte Felix Schläpfer von der Fachhochschule Kalaidos. Doch das sei keine Lösung.
«Schon heute wird in der Schweiz die letzte Einheit von Landwirtschaftsgütern vergleichsweise umweltschädlich hergestellt», sagt Schläpfer. Das heisst: Wenn die Landwirtschaft beispielsweise noch mehr Milch oder Rindfleisch produzieren soll, kämen diese Nahrungsmittel nicht von Tieren, die auf einer Alpweide grasen, sondern von solchen, die mit importiertem Kraftfutter gemästet werden.
Die Zielkonflikte zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Umweltschutz sind nicht neu. Aber wenn die Bevölkerung stark wächst, verschärft dies tendenziell die Probleme. Die Schweiz ist ein kleines Land mit wenig landwirtschaftlich bebaubarer Fläche. Diese wird entsprechend intensiv genutzt. Die Ernährungsfrage lässt die Bevölkerung nicht kalt. Allein seit 2016 sind sieben agrarpolitische Volksinitiativen an die Urne gekommen – weit mehr als in früheren Jahrzehnten.
Wege zu einer umweltfreundlicheren Ernährung
«Wir sollten die heutigen landwirtschaftlichen Produktionsweisen nicht einfach fortführen», sagt auch Robert Finger, Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH Zürich. «Man kann in der Schweiz grundsätzlich mehr Menschen ernähren. Aber dann sollte anders produziert werden, und die Ernährungssysteme sollten angepasst werden.»
Für Finger besteht die Lösung nicht in einem «Weiter so». Man solle vielmehr versuchen, die Zielkonflikte zwischen Ernährung und Umweltschutz zu entschärfen. Dafür sieht der Wissenschafter verschiedene Stellschrauben.
Erstens könne die Effizienz erhöht werden. Beispielsweise werden immer noch viele Nahrungsmittel verschwendet. «Wenn es uns gelingt, Food-Waste zu verringern, kommen wir mit weniger Lebensmitteln aus. Das ist ein wichtiger Hebel.»
Auch in der Produktion kann effizienter gearbeitet werden. Ein Weg dabei ist das sogenannte Precision-Farming: Beispielsweise werden Pflanzenschutzmittel gezielt mittels digitaler Technologien ausgebracht, womit weniger Giftstoffe in die Umwelt gelangen. Die Landwirtschaft wird so umweltfreundlicher.
Eine zweite Stellschraube sieht Finger in der Substitution. In der Landwirtschaft liessen sich chemische Pflanzenschutzmittel durch biologische Alternativen ersetzen. Beim Konsum wäre es sinnvoll, wenn die Menschen weniger tierische Proteine essen und stattdessen mehr pflanzliche Eiweisse zu sich nehmen würden.
Ein dritter Weg ist schliesslich ein «grosser Wurf»: ein grundlegender Umbau der Ernährungssysteme hin zu einer langfristig tragfähigen Landwirtschaft.
Mehr Importe als Ausweg
Solche Vorschläge sind auf die Produktion im Inland ausgerichtet. Doch es gäbe auch eine grundlegende Alternative: Bei wachsender Bevölkerung könnte die Schweiz mehr Lebensmittel aus dem Ausland importieren. Bereits heute wird rechnerisch gesehen jede zweite Kalorie, die hierzulande konsumiert wird, durch ausländische Nahrungsmittel gedeckt. Mehr Importe wären ein naheliegender Weg, um mehr Menschen zu ernähren.
Allerdings ist dies ein rotes Tuch für jene Gruppen, die an einer Produktion im Inland interessiert sind. So kritisiert etwa der Bauernverband, dass schon heute ein zu grosser Teil der Lebensmittel aus dem Ausland komme. Die gleiche Stossrichtung verfolgt die angekündigte SVP-Volksinitiative, die den Selbstversorgungsgrad erhöhen will.
Falsch verstandener Selbstversorgungsgrad
Tatsächlich ginge mit mehr Importen der rechnerische Selbstversorgungsgrad zurück. Doch wäre das ein Problem? Das Mass wird in der öffentlichen Diskussion oft missverständlich verwendet. Der Selbstversorgungsgrad hat wenig mit Versorgungssicherheit zu tun. Er misst nur, wie viele Kalorien die Schweizer Bauern in normalen Zeiten produzieren. Aber er sagt nichts darüber aus, was die heimische Landwirtschaft in einer Krisensituation, in der sie autark operieren müsste, hervorbringen könnte.
Versorgungssicherheit lässt sich vor allem dann gewährleisten, wenn man importieren kann. Das zeigten beispielsweise einheimische Mangelernten bei Kartoffeln in den vergangenen Jahren. Die Schweizer Konsumenten fanden jeweils nur darum genügend Kartoffeln in den Läden, weil sie im grossen Stil aus dem Ausland eingeführt werden konnten.
Ausländische Produkte sind nicht umweltschädlicher
Eine weitere Kritik an höheren Lebensmittelimporten lautet, dass man damit die umweltschädlichen Wirkungen des Nahrungsmittelkonsums einfach ins Ausland verschieben würde – oder noch schlimmer: den ökologischen Fussabdruck sogar vergrössern würde. «Die ausländische Lebensmittelproduktion ist mit einer grösseren ökologischen Belastung verbunden als jene im Inland», heisst es etwa beim Bauernverband. «Je weniger wir im Inland produzieren und dafür importieren, umso mehr belastet das Essen die Erde.»
Die Sicht, dass Schweizer Produktion deutlich besser sei als ausländische, ist populär. Aber sie wird durch die wissenschaftliche Literatur nicht gestützt. So untersuchte eine Studie von Agroscope, der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt des Bundes, im Jahr 2015 die Ökobilanz von Schweizer Landwirtschaftsprodukten im Vergleich mit importierten Lebensmitteln.
Die Studie kam zum Schluss: «Von den untersuchten Produkten waren nur Käse und Kartoffeln aus der Schweiz fast ausschliesslich ähnlich oder günstiger zu bewerten als Importe.» Bei anderen Produkten wie Weizenbrot, Futtergerste und Rindfleisch hingegen konnten keine eindeutigen Unterschiede zu Importen aus Nachbarländern wie Deutschland und Frankreich gefunden werden.
Eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) hat zudem untersucht, wie sich eine Marktöffnung auf die Umweltbilanz des Schweizer Nahrungsmittelkonsums auswirken würde. Eines der analysierten Szenarien ist eine Marktöffnung gegenüber der EU, welche die Preisdifferenz zwischen inländischen und EU-Lebensmitteln halbieren würde. Die Umweltwirkungen eines solchen Schrittes wären gering. Die Gesamtumweltbelastung des hiesigen Nahrungsmittelkonsums würde sich nur um 1 Prozent erhöhen. Leicht grösser wäre der Effekt bei einer Marktöffnung gegenüber der ganzen Welt (+2,2 Prozent).
Abkehr von alten Pfaden
Das Argument des Umweltschutzes steht damit einem grösseren Import von Lebensmitteln nicht entgegen. Wahrscheinlich wäre es sogar so, dass eine stärkere Schweizer Importnachfrage die Ökobilanz der Bauern im Ausland verbessern würde. Mit ihrer hohen Kaufkraft könnten sich die Schweizer beispielsweise problemlos Bio-Lebensmittel aus Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich leisten, denn sie kosten nicht mehr als konventionell produzierte Ware aus der Schweiz. Dadurch entstünde ein Anreiz für eine nachhaltigere Produktion im Ausland.
Es gibt mithin Wege, wie sich die Bevölkerung ernähren lässt, wenn die Schweiz dereinst zehn Millionen Einwohner zählt. Aber notwendig ist eine Abkehr von bisherigen Pfaden. Die Diskussion über die Zuwanderung zeigt damit auch zwei grundlegende Herausforderungen auf, denen sich die Landwirtschaftspolitik stellen muss. Im Inland sollte anders und ökologischer produziert werden. Und die Schweiz sollte offener werden für mehr Nahrungsmittelimporte.