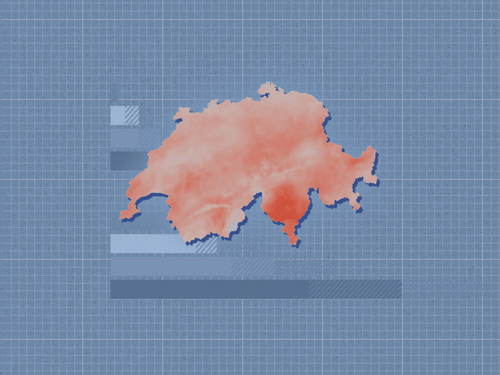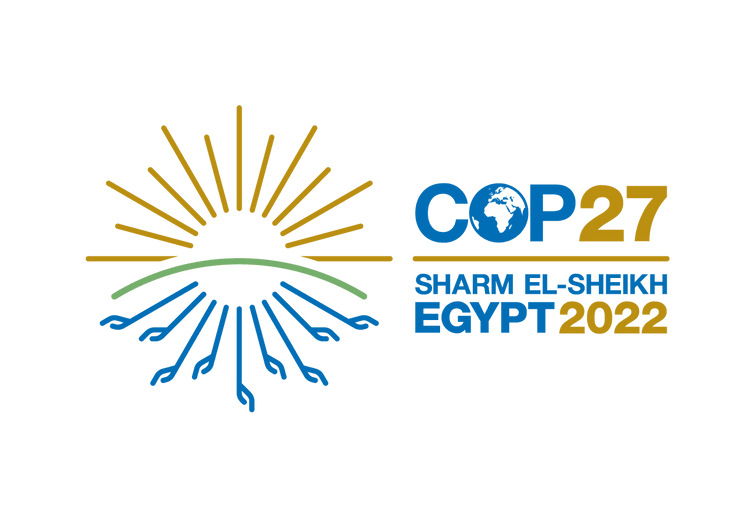Ab Montag sitzt die ganze Welt wieder an einem Tisch. Unabhängig, ob Regierungen für oder gegen einen verschärften Klimaschutz sind, sie alle nehmen die Reise nach Brasilien auf sich.
Auch die USA. Die Amerikaner ziehen sich zwar aus dem Pariser Abkommen zurück, aber von den Klimaverhandlungen können sie nicht lassen. China hat sogar im Voraus ein neues Klimaziel für 2035 verkündet: Der weltgrösste Verschmutzer plant weiterhin, Milliarden in saubere Technologien zu investieren.
Das Format der multilateralen Klimaverhandlungen ist unter Druck, aber weiterhin relevant. Was steht in diesem Jahr an? Die NZZ hat sich mit drei Aspekten beschäftigt.
Neue Klimaziele sind von der EU und anderen Verschmutzern gefordert
China plant, die eigenen Emissionen bis 2035 um bis zu 10 Prozent zu reduzieren: Das ist zu wenig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Aber es ist das erste Mal, dass sich der weltgrösste Verschmutzer formell verpflichtet, Emissionen zu reduzieren.
Die EU, der viertgrösste Emittent der Welt und selbsternannter Weltmeister beim Klimaschutz, hat noch kein neues Emissionsziel verkündet. Und das, obwohl gemäss den Regeln des Pariser Abkommens dieses Jahr eigentlich alle Regierungen gefordert waren, neue Klimaziele für 2035 einzureichen.
Die Europäer sind nicht die Einzigen, die die Deadline verpasst haben. Viele Schlüsselländer müssen sich noch zu neuen Plänen durchringen. Darunter ist auch Indien, dessen Emissionen seit Jahren wachsen und das nun vor der EU zum drittgrössten Emittenten der Welt aufgestiegen ist.
Das Klimasekretariat der Uno, das Herz des multilateralen Klimaregimes, hat kürzlich eine erste Analyse zum Stand der weltweiten Emissionsreduktionen veröffentlicht. Die Analyse ist begrenzt, sie stützt sich auf Pläne, die nur rund 30 Prozent der weltweiten Emissionen abdecken.
Trotzdem zeigt sie klar, was allgemein bekannt ist: Die geplanten Emissionsreduktionen sind viel zu gering, um die Klimaziele zu erreichen. Noch wachsen die Emissionen. Vergangenes Jahr erreichten sie einen neuen Höchstwert, angetrieben von Indien, Russland sowie Indonesien und anderen wachsenden Schwellenländern.
Die jüngsten Zahlen machen deutlich: Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens ist vorerst nicht mehr umsetzbar, das rhetorische Festhalten daran unglaubwürdig. Forscher sagen dies seit langem, nun hat auch die Uno begonnen, das in ihre Reden einzubauen.
Aber die Analyse der Klimapläne zeigt auch, dass die Energiewende in vielen Ländern der Welt anläuft. In den kommenden zehn Jahren werden die Emissionen dank den Klimaplänen sinken, um 10 Prozent im Vergleich zum Niveau von 2019. Diese Entwicklung, so die Uno, deute in die richtige Richtung. Die «enormen Investitionsströme in saubere Energien in fast allen grossen Volkswirtschaften» seien ermutigend. Beispielsweise haben die erneuerbaren Energien in diesem Jahr die Kohle als weltweit grösste Stromquelle überholt.
Die Uno spricht in ihrer Analyse auch die Klimafolgen an. Die Welt zahle bereits jetzt «einen hohen Preis» für die globale Erwärmung, zugleich nähere sie sich «einem positiven wirtschaftlichen Wendepunkt». Die Verhandlungen in Belém werden weitere Hinweise darauf geben, ob und unter welchen Bedingungen sich die globale Energiewende beschleunigen wird.
Anpassung an den Klimawandel im Zentrum
Um glaubwürdig zu bleiben, muss die Klimakonferenz Lösungen aufzeigen, damit sich Länder besser gegen Hochwasser, Hitzewellen, Waldbrände und Dürren wappnen können. Jede vorausschauend für eine heissere Welt gebaute Strasse oder Schule zeigt konkret, warum eine durchdachte Klimapolitik für den Alltag relevant ist.
Die Anpassung an den Klimawandel sei zwingend nötig, schrieb André Aranha Corrêa do Lago im Oktober. Sie sei genauso wichtig wie die Aufgabe der Emissionsreduktionen. Der brasilianische Diplomat übernimmt die Führung der Konferenz in diesem Jahr.
Diese Verschiebung – oder besser: Ausweitung – der klimapolitischen Prioritäten ist wichtig. Und es hat lange gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat. Seit Jahren fordern Entwicklungsländer einen stärkeren Fokus auf die dringende Aufgabe, ihre Bevölkerungen gegen die Gefahren des Klimawandels zu wappnen.
Die Menschen interessiere nicht der klimapolitische Jargon, schrieb Corrêa do Lago. «Sie sprechen von überfluteten Häusern und Ernteausfällen, vom Zusammenbruch der lokalen Wirtschaft nach Stürmen, von zerstörten Schulen und Krankenhäusern».
Aber Aktivisten und grün gesinnte Politiker haben das Thema jahrelang heruntergespielt. Sie waren besorgt, dass der Fokus den Druck von den benötigten Emissionsminderungen nimmt. Dies hat vor allem dazu geführt, dass ein Thema, das für viele Länder zunehmend lebenswichtig ist, lange stiefmütterlich behandelt wurde.
Bis jetzt. Denn für Brasilien steht die Anpassung im Zentrum der diesjährigen Klimakonferenz. Nachdem der Hurrikan «Melissa» vergangene Woche in der Karibik gewütet und grosses Leiden verursacht hat, wird das Thema auch bei vielen anderen Entwicklungs- und Schwellenländern absolute Priorität haben.
Billionen für den Klimaschutz
Damit sich Länder jedoch auf die Risiken des Klimawandels einstellen können, braucht es viel Geld. Aber die Investitionen in den Hochwasserschutz oder hitzeresistente Infrastruktur liegen weit hinter dem, was laut Experten benötigt wird.
Die Finanzierung dieser Bereiche macht laut der Uno weniger als ein Drittel der gesamten Klimafinanzierung durch Industriestaaten aus. Diese «chronische Unterinvestition» setze Länder Risiken aus und zwinge sie dazu, knappe Ressourcen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Infrastruktur für Notfallmassnahmen und Wiederaufbau umzuwidmen, schrieb Corrêa do Lago.
Während der kommenden Wochen werden Diplomaten darüber verhandeln, wie die finanzielle Unterstützung durch Regierungen gesteigert werden kann und Investitionen auch für die Privatwirtschaft attraktiver gemacht werden können.
Brasilien arbeitet daran, auf der Konferenz ein Finanzpaket zugunsten der Entwicklungsländer auf die Beine zu stellen. Die Geldgeber, sagte Corrêa do Lago, seien ein Mix aus reichen Industriestaaten, philanthropischen Einrichtungen und multilateralen Entwicklungsbanken.
Noch sind die Details unklar, aber das Thema ist schon auf der Agenda einiger reicher Geldgeber. Bill Gates etwa, der milliardenschwere Gründer von Microsoft, forderte im Oktober ein Umdenken, um die Klimapolitik wirksamer zu machen. Regierungen sollten lieber mehr Ressourcen in die Anpassung und Verbesserung der Lebensaussichten stecken, als sich nur am Ziel der Emissionsreduktionen zu orientieren.
Für Entwicklungsländer sind die Klimaverhandlungen ein zentrales Forum, um über finanzielle und technologische Hürden zu sprechen, die Energiewende umzusetzen und Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel auszuarbeiten. Für viele dieser Länder geht es bei der Diskussion nicht nur um die klimapolitische, sondern auch um eine wirtschaftliche Dimension.
Sie wollen über die Barrieren im internationalen Finanzmarkt und die für den Ausbau des Energiesystems notwendigen Gelder sprechen. Zudem fordern Entwicklungsländer seit Jahren den Austausch von technologischem Know-how und eine grössere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Anpassung gegen die schädlichen Folgen des Klimawandels.
Eine Flutwelle zerstört nicht nur Dörfer, sondern auch Fortschritt. Viele Länder bleiben auf den Kosten sitzen – und ihre Schulden wachsen.
Die finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer ist jedes Jahr aufs Neue ein grosser Streitpunkt bei den Verhandlungen zwischen den Regierungen. Auf der Klimakonferenz in Baku in Aserbaidschan verpflichteten sich die Industrieländer dazu, bis 2035 jährlich 300 Milliarden Dollar für die Klimafinanzierung bereitzustellen.
Viele Entwicklungsländer kritisierten dieses Ergebnis als unzureichend. Die Arbeit geht in diesem Jahr weiter, mit dem Ziel, die jährlichen Geldflüsse für den Klimaschutz mithilfe von privaten Investoren und Entwicklungsbanken auf insgesamt 1,3 Billionen Dollar zu erhöhen.
Für Brasilien geht es dabei um mehr als nur um Geld. Die USA treten aus dem Pariser Abkommen aus und nutzen ihren politischen Apparat, um klimapolitisch zu bremsen. Gleichzeitig ist der grüne Enthusiasmus der vergangenen Jahre der Ernüchterung gewichen.
In vielen Ländern wächst der politische Widerstand gegenüber dem Aufwand der Energiewende. In Belém wird es in den kommenden Wochen also auch darum gehen, der klimapolitischen Agenda neuen Schwung zu geben. Die Verhandlungen müssen zeigen, dass Regierungen aus aller Welt weiterhin an der Energiewende arbeiten und gemeinsam Lösungen angesichts der Gefahren des Klimawandels finden können.
Darin sieht auch Corrêa do Lago seine Aufgabe. «Wir müssen vermitteln, dass es bei dieser (Klima-)Agenda Fortschritte gibt, denn wir befinden uns in einer Phase, in der die Mehrheit der Öffentlichkeit glaubt, dass diese Agenda an Boden verliert», sagte er nur wenige Tage vor Beginn der Konferenz.