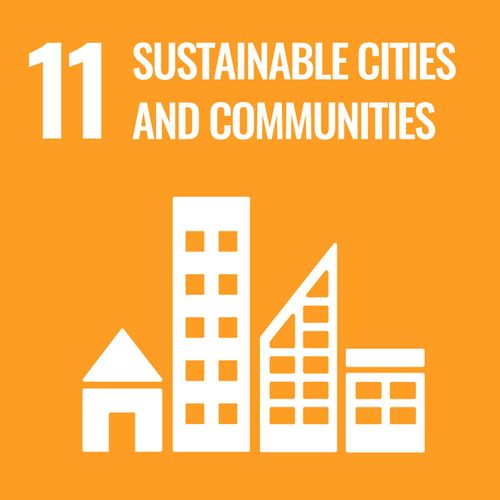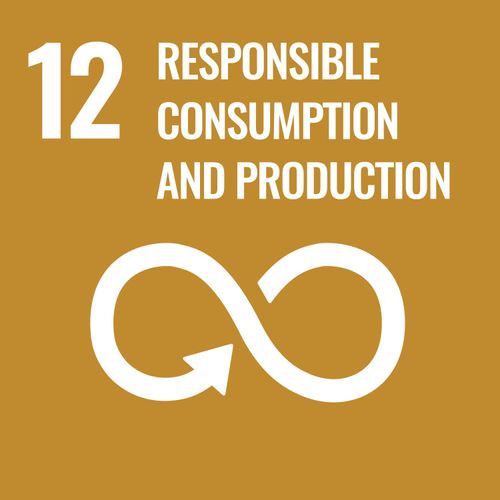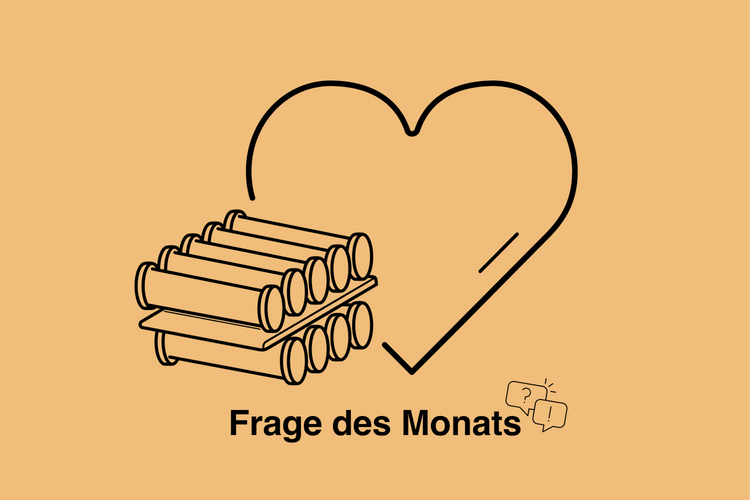Jedes Jahr werden in der Schweiz nach Angaben des Bundesamts für Polizei fedpol rund 1600 Tonnen Feuerwerkskörper verkauft. Hinter den schillernden Verpackungen aus Karton, Kunststoffen oder Holz verbergen sich rund 400 Tonnen pyrotechnische Feuerwerkssätze. Diese bestehen neben Schwarzpulver auch aus farbgebenden Metallverbindungen. Beim Abbrennen entstehen daraus etwa 300 Tonnen Feinstaub – und der gelangt als Niederschlag auch in Böden und Gewässer.
Wie rasch die Feinstaubbelastung nach dem Feuerwerk nachlässt, hängt vor allem von den Wetterverhältnissen ab. Bei nur schwachem Wind verbleiben die Schadstoffe oft über Stunden oder Tage in der Luft – sie sind damit wahre Klimakiller. Zudem geht es um gewaltige Mengen. Laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) werden schweizweit aktuell rund 14'000 Tonnen Feinstaub pro Jahr ausgestossen, vor allem an Silvester und zum 1. August. Feuerwerke tragen so etwa 2 Prozent zur jährlichen Gesamtbelastung bei.
Hinzu kommt: Jeder Feuerwerkskörper erzeugt beim Abbrennen Kohlendioxid als Nebenprodukt. Allein beim Entzünden von einer Tonne Pyrotechnik werden 156 Kilogramm klimarelevantes CO₂ ausgestossen. Zum Vergleich: Eine Autofahrt von Luzern nach Rom verursacht 160 Kilogramm CO₂-Emissionen.
Der Rauch, der beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern entsteht und Feinstaub erzeugt, kann bei empfindlichen Menschen zu Atembeschwerden und Husten führen – erst recht bei windstillem Wetter. Personen mit Atembeschwerden und mit Kreislauferkrankungen sollten darum die Nähe von Feuerwerken meiden, warnt das Bundesamt für Umwelt.
Zudem könne der Lärm beim Abbrennen der Raketen und Böller zu bleibenden Gehörschäden führen. Auch für Haus- und Wildtiere sei der plötzliche Lärm eine grosse Belastung, so das Bafu.
Umwelt- und Tierschutzorganisationen kritisieren die Pyro-Knallerei am 1. August darum schon seit Jahren. Gefordert wird, dass besonders Privatpersonen keine lauten Feuerwerke mehr abbrennen dürfen. Die Rechnung ist einfach: Je weniger Feuerwerkskörper in den Himmel gejagt werden, desto geringer ist die Umweltbelastung. Kritiker verweisen darauf, dass auch die Rückstände der Feuerwerkskörper wie zum Beispiel Kunststoff-, Aluminium- und Bleipartikel in den Boden gelangen und das Grundwasser sowie Flüsse und Seen verschmutzen können. Angeführt wird zudem die Brandgefahr, besonders bei trockenen, windigen Wetterbedingungen.
Auch wenn das Feuerwerk noch immer fester Bestandteil des Schweizer Nationalfeiertags ist, machen sich mancherorts Veranstalter und Gemeinden Gedanken über Alternativen. So wie zum Beispiel die Gemeinde Neuenegg (BE). Dort ist man dazu übergegangen, beleuchtete Wasserfontänen im Takt der Musik tanzen zu lassen – eine Lichtershow ganz ohne Knalleffekte. Die Stadt Bern wiederum hat 2022 ein spektakuläres Drohnenballett lanciert. Dies, nachdem das Stadtparlament im Jahr zuvor einen Verzicht auf das traditionelle Feuerwerk auf dem Hausberg Gurten beschlossen hatte. Andernorts sind Gemeinden und Kantone dazu übergegangen, die Regeln zu verschärfen. In einigen Ortschaften des Bündnerlandes ist das Abbrennen von Feuerwerk inzwischen gänzlich verboten. Teilweise ausgenommen ist davon nur Stilles Feuerwerk (etwa Vulkane, Wunderkerzen und bengalische Feuer).
Schon bald dürfte das Schweizer Volk über die Zukunft der Feuerwerke abstimmen. Die von Naturschützern eingereichte Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» verlangt einen stärkeren Schutz von Menschen, Tieren und der Umwelt vor Lärm und Emissionen. Sie will insbesondere den Verkauf und die Verwendung von lauten Feuerwerkskörpern für Private in der ganzen Schweiz verbieten. Feuerwerkskörper, die keinen Lärm erzeugen, könnten hingegen weiterhin verkauft werden, hiess es. Zudem könnten für überregionale Veranstaltungen Ausnahmebewilligungen erteilt werden, etwa für 1.-August-Feiern. Der Bundesrat hat sich schon gegen die Initiative positioniert. Kantone und Gemeinde verfügten bereits über die erforderlichen Rechtsgrundlagen, um Feuerwerke einzuschränken, so die Begründung.