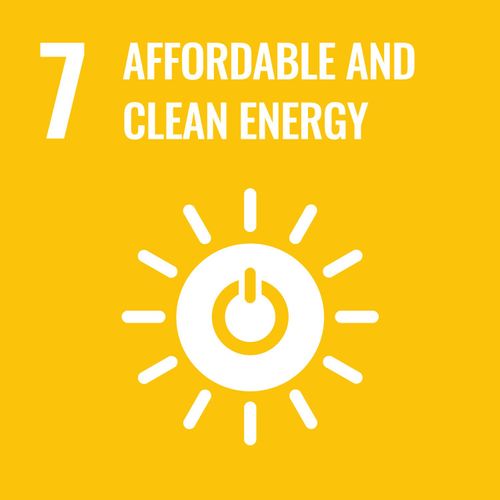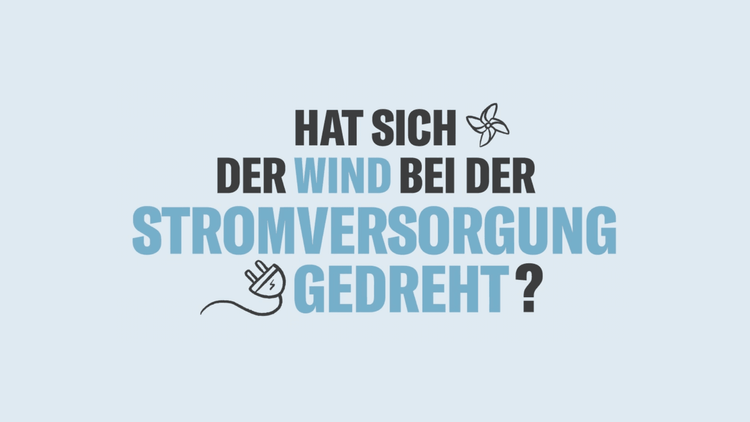Moderne Windparks in der Nordsee haben riesige Ausmasse. 175 Windräder stehen, aufgereiht wie Spargeln in einem Beet, etwa im «London Array» vor der englischen Ostküste. Auch Betreiberfirmen in anderen Anrainerstaaten haben Hunderte Anlagen ins Meer gepflanzt. Alle wollen sie den Wind ernten und Strom daraus gewinnen.
Wer an einem Nordseestrand in einer steifen Brise steht, könnte meinen, Wind sei eine unerschöpfliche Ressource. Aber das ist ein Trugschluss. Vielmehr stehlen die Windräder einander den Wind. Denn Rotorblätter bremsen den Luftzug, welcher sie antreibt – und dieser verlangsamende Effekt reicht nicht nur bis zur nächsten Turbine.
Die Abschwächung des Luftzugs erstreckt sich teilweise 100 Kilometer weit, wenn man die Wirkung eines ganzen Windparks auf den nächsten betrachtet. Das Problem ist in der Nordsee inzwischen so gross, dass es für messbare Stromeinbussen und ernste Diskussionen sorgt. Auch der weitere Ausbau der Windenergie gerät in Schwierigkeiten.
Doch es gibt Gegenmittel. Wissenschafter haben mehrere Ideen entwickelt, wie man den Abschattungseffekt verringern könnte, auf technische oder auf organisatorische Weise. Wie liesse sich das umsetzen?
Auch der Nachschub an Wind ist endlich
Das Grundproblem ist schnell erklärt: Der Wind, der Bäume biegt, Turbinen antreibt und durch Reibung am Boden schliesslich einschläft, braucht ständig Nachschub – und zwar von oben. Der Antrieb kommt von starken Winden in höheren Luftschichten, und dieser Nachschub ist begrenzt. Bestückt man das Meer mit zu vielen Turbinen, geht er irgendwann zur Neige. Dann schwächen sich die Winde nahe der Erdoberfläche ab, und der Stromertrag der Anlagen sinkt.
Der deutsche Physiker Axel Kleidon machte schon vor mehr als zehn Jahren darauf aufmerksam, dass die Ressource Wind endlich ist. Besonders dringend sei das Problem in der südlichen Nordsee – dort sei die geplante Dichte an Windrädern so gross wie in keiner anderen Region der Welt, sagt der Wissenschafter, der am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena forscht.
Vor allem im belgischen und im deutschen Bereich der Nordsee sind pro Fläche sehr viele Anlagen vorgesehen. Diese beiden Länder seien so dicht besiedelt, dass es dort nur wenig Platz für Windenergie gebe, sagt Kleidon. Und weil das eigene Küstenmeer der beiden Länder jeweils klein sei, habe man dort gemessen an der Fläche besonders viele Windräder geplant.
Ändert sich nichts, sinkt der Stromertrag pro Fläche weiter
Manche Windparks in Deutschland spüren die Wirkung der Abschattung heute schon. Vor allem jene, in deren Umgebung nachträglich weitere Anlagen gebaut wurden. Je nach Standort falle der Ertrag um bis zu 15 Prozent niedriger als geplant aus, sagt die Ökonomin Karina Würtz von der Stiftung Offshore-Windenergie in Berlin.
In Zukunft könnte der Stromertrag der Windräder noch deutlich stärker sinken. Läuft der Ausbau in der Nordsee wie geplant, reduziert sich der Ertrag pro Windpark um bis zu 30 Prozent gegenüber der ursprünglichen Erwartung – das ist einer Studie zu entnehmen, die Kleidon neulich gemeinsam mit Felix Fliegner und Thure Traber vom Netzbetreiber 50Hertz in Berlin veröffentlicht hat. Die Autoren eines Berichts vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Bremerhaven kamen auf ähnliche Zahlen.
In Deutschland habe die vorherige Bundesregierung einen Anstieg der installierten Leistung von derzeit knapp 10 auf 70 GW bis 2045 auf Nord- und Ostsee gesetzlich verankert, sagt Fliegner. Der Flächenanteil Deutschlands sei dabei kleiner als beispielsweise der von Dänemark, Grossbritannien oder den Niederlanden.
«Nach dem Abzug von militärischen Übungsgebieten, Naturschutzgebieten, Flächen für die Fischerei, dem Sand- und Kiesabbau sowie für Forschung und Schiffsverkehr bleiben zwar ausreichend viele Flächen übrig», sagt Fliegner. Diese Flächen seien aber wegen der Verschattung nicht so ergiebig wie erhofft – teilweise liege dies auch an den immer grösseren Rotorblättern.
Höher bauen löst das Grundproblem nicht
Um der Abschattung entgegenzuwirken, diskutieren Wissenschafter mehrere Ansätze. Ein Ansatz ist technischer Art: Man könnte zum Beispiel die einzelnen Windkraftanlagen anders konstruieren. Windräder unterschiedlicher Höhe würden mehr Ertrag bringen, als wenn sich alle Turbinen eines Windparks auf dem gleichen Niveau drehten.
Der technische Ansatz löst das grundsätzliche Problem in der Nordsee aber nicht. Es würde allenfalls auf benachbarte Windparks verlagert. Insgesamt entzieht man der Atmosphäre pro Fläche einfach zu viel Windenergie.
Forscher schlagen darum vor, grössere Lücken zwischen den Turbinen und den Windparks zu lassen – oder den Ausbau international zu koordinieren. «Man braucht einfach mehr Fläche», sagt Kleidon. Die Windparks sollten gleichmässiger geplant werden. Dann wäre die Dichte der Windräder in verschiedenen Gebieten ungefähr gleich gross.
Derzeit sei es so, dass erst einmal jedes Land für sich plane, sagt die Ökonomin Karina Würtz. Wenn ein Land Flächen für Windräder ausweisen wolle, gebe es zwar ein Konsultationsverfahren. Der effizienteste Weg wäre aber eine gemeinsame, internationale Planung der Flächenentwicklung.
Liessen sich die Länder auf eine Kooperation ein, hätten sie zusammen einen höheren Ertrag. Vor allem Länder mit kleinen Flächenanteilen an der Nordsee wie Belgien oder Deutschland könnten von der Zusammenarbeit profitieren.
Die Windparks könnten auf grössere Flächen verteilt werden
Fliegner, Kleidon und Traber plädieren für eine räumliche Entzerrung der Windparks sowie mehr Kooperation und Vernetzung, wo es netztechnisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist.
Manche Fachleute erwägen, Windparks in Dänemark zu bauen, aber den Strom für Deutschland zu nutzen. Würtz hält das für sinnvoll. «Dänemark besitzt deutlich mehr Meeresfläche, als das Land für den eigenen Strombedarf benötigt», sagt sie. Bei Deutschland sei es umgekehrt.
Bei der Anbindung neuer Windparks vor der dänischen Küste an das deutsche Stromnetz treten allerdings politische wie technisch-regulatorische Schwierigkeiten auf. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wie die Kosten und Erlöse zwischen Dänemark und Deutschland geteilt werden sollen, wenn ein Windpark in dänischen Gewässern steht, aber der Strom ausschliesslich nach Deutschland fliesst und dort nach der geltenden Rechtslage vergütet wird. Probleme könnte auch die Verlegung der Kabeltrassen via deutsche Nordseeinseln aufwerfen.
Eine technische Lösung, die bei der Einbindung neuer Windparks im Ausland Abhilfe schaffen könnte, ist die doppelte Nutzung von Seekabeln. Einerseits verknüpfen sie die Stromnetze zweier Länder miteinander, andererseits lassen sich damit Offshore-Windparks anschliessen.
Ein solches Modell wurde in der Ostsee zwischen dem deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz und seinem dänischen Pendant Energinet unter dem Namen «Combined Grid Solution» bereits umgesetzt. Dabei sind drei Offshore-Windparks eingebunden, zwei auf deutscher und einer auf dänischer Seite. Diese technische Lösung erlaubt es, Windparks grossräumiger zu verteilen als bisher. Dadurch erhöht sie bei gleichbleibender Anzahl von Windrädern den Stromertrag deutlich.
Windparks in der Ostsee können sich übrigens aus einem einfachen Grund lohnen: Dort komme der Wind zu einem späteren Zeitpunkt an als in der Nordsee, sagt Würtz. Dann sei der Börsenstrompreis wieder gestiegen, und die Windparks in der Ostsee könnten davon profitieren. Das Beispiel zeigt: Es könnte helfen, Windparks über mehrere Meere zu verteilen, statt sie in einer Region zu konzentrieren. Sicher ist, dass das Thema Abschattung die Branche noch auf Jahre hinaus beschäftigen wird.