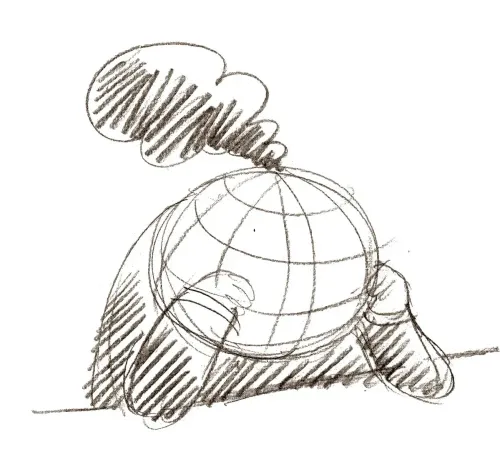Oft geht die Naturromantik mit einer nostalgischen Betrachtung der Vergangenheit einher. Nach dieser Vorstellung soll das Verhältnis zwischen Natur und Mensch früher noch in Ordnung gewesen sein. «Für die Natur war diese Zeit gut, weil es weniger Menschen gab», sagt Ruishalme. Aber auch für die Menschen? «Das war ja kein Leben, von dem wir denken, dass unsere Kinder das führen sollten.» Sie zitiert Hans Rosling, einen schwedischen Arzt und Bestsellerautor: «Die Menschen haben früher nicht im Gleichgewicht mit der Natur gelebt, sie sind im Gleichgewicht mit der Natur gestorben.»
Das Netzwerk WePlanet, zu dessen Gründerinnen Ruishalme zählt, neigt nicht zur Naturromantik, sondern verfolgt einen sehr pragmatischen Ansatz. Dabei haben auch technologische Lösungen ihren Platz.
Das Ziel ist aber keineswegs, alle Umweltprobleme mit Hightech zu beantworten, wie dies manche Techno-Optimisten propagieren. Es geht den Mitgliedern von WePlanet vielmehr darum, dass keine Lösungsmöglichkeit, keine Technologie schon von Anfang an aus der Diskussion ausgeschlossen wird.
Die Ziele einer Umweltorganisation seien immer weltanschaulich geprägt, sagt Martin Reich. «Aber wenn es um die Mittel geht, mit denen man diese Ziele erreichen will, muss man Evidenz verwenden. Wir versuchen, das komplett offen zu machen.»
Reich erwähnt das Beispiel Laborfleisch – beziehungsweise, wie er es lieber nennt: Fleisch aus Zellkulturen. Ernährung sei ein emotionales Thema, und Fleisch aus Zellkulturen werde zum Teil mit irrationalen Argumenten diskriminiert, sagt er. Dabei vergrössere sich dank der neuen Technologie einfach nur die Auswahl für die Konsumenten. «Wir lobbyieren nicht für das Fleisch aus Zellkulturen, aber man sollte es nicht verbieten», sagt er. «Wenn die Diskussion abgewürgt werden soll, versuchen wir unseren Einfluss geltend zu machen.»
Eine Kosten-Nutzung-Abwägung habe man eigentlich immer, sagt Fritschle. «Ich glaube, wenn man das nicht so präsent hat, neigt man dazu, das zu vergessen, und fokussiert auf Argumente, die man gerade kennengelernt und zur Hand hat. Argumente, die in der eigenen Bubble präsent sind. Dann neigt man dazu, die Pros oder Cons zu verdrängen.»
Um Technologien angemessen zu bewerten, muss man aber zwangsläufig das Für und Wider bedenken. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Mitglieder von WePlanet einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das habe allerdings auch einen Nachteil, sagt Ruishalme. Mit Wissenschaftern eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zu führen, sei nicht einfach. Blümm sieht das ähnlich: «Wir sprechen rational denkende Menschen an – das sind nicht die, die sagen, sie gingen zu einer Demo.»
Auch mit der Finanzierung sei es schwierig, sagt Blümm. Die grossen Umweltorganisationen seien ihnen völlig überlegen. Die seien schon lange dabei, gut vernetzt, durch die Institutionen marschiert. «Davon sind wir noch ganz weit weg.»
Wachstum und Nachhaltigkeit schliessen sich nicht aus
Die Hauptbotschaft von WePlanet, dem Dachverband der wissenschaftsnahen Umweltschützer, ist eine positive: Wohlstand erhalten, aber trotzdem nachhaltiger werden. Reich findet das ganz richtig so: «Ich glaube nicht, dass Degrowth die Lösung bringen kann. Damit lügen wir uns in die eigene Tasche.» Stattdessen müsse es das Ziel sein, Wohlstand und Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch und Emissionen zu entkoppeln, um innerhalb der planetaren Grenzen zu agieren. Diese Botschaft fange die ein, die sich von den grossen Umweltorganisationen abgewendet hätten.
Eines wollen die pragmatischen Umweltschützer in diesen Zeiten wachsender Polarisierung gerne vermeiden: sich einer bestimmten politischen Richtung zuordnen zu lassen. «Wir wollen inklusiv sein», sagt Ruishalme. Also weder links noch rechts. Das Verbindende soll die sachliche Auseinandersetzung mit der besten Lösung sein.
Nach dieser Denkweise können gentechnisch veränderte Pflanzen, die Kernenergie oder künstliches Fleisch aus dem Labor praktikable Lösungen im Hinblick auf den Umweltschutz sein – mit der Betonung auf «können». Sie müssen nicht unbedingt zum Einsatz kommen, aber sie sollen offen zur Debatte stehen. Für viele Umweltschützer ist das ein ketzerischer Gedanke – aber nicht für alle.