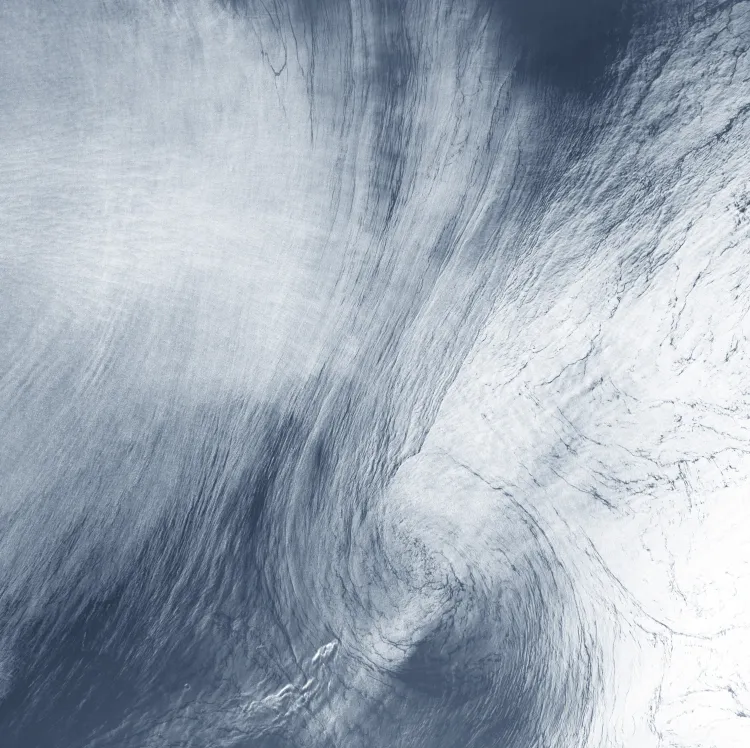Die Kollisionsgefahr steigt allmählich an
Auf den ersten Blick wirkt es segensreich, wenn die Satelliten länger die Erde umkreisen. Denn dadurch können sie über längere Zeit genutzt werden. Allerdings ist es dann auch nicht mehr so leicht, sie nach ihrem Betriebsende loszuwerden.
Satelliten in den niedrigsten Umlaufbahnen lässt man am Ende der Betriebsdauer meistens von selbst abstürzen und in der Atmosphäre verglühen. Weil die äusseren Luftschichten schrumpfen, vergeht bis zu diesem automatischen Absturz nun immer mehr Zeit.
Noch problematischer ist, dass auch der Weltraummüll immer länger im All verweilt. Wenn die Atmosphäre schrumpft, brauchen Trümmerwolken, die aus den Zusammenstössen von Satelliten oder anderen Objekten hervorgehen, deutlich länger, bis sie absinken.
Schon seit geraumer Zeit befürchten Fachleute, dass eines Tages ein Schneeballeffekt im All einsetzen könnte: In diesem Szenario entstünden durch Kollisionen immer neue Trümmerteile, die weitere Kollisionen verursachten – das ist das sogenannte Kessler-Syndrom. Benannt ist es nach Donald Kessler, einem amerikanischen Astronomen, der bereits im Jahr 1978 warnend auf diese Gefahr hinwies.
William Parker vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge hat jetzt gemeinsam mit zwei Kollegen in Grossbritannien mithilfe von Berechnungen untersucht, wie der Klimawandel das Risiko des Kessler-Syndroms verändert.
Die Umlaufbahnen können weniger Satelliten aufnehmen
Die Fähigkeit der tiefen Umlaufbahnen, Satelliten aufzunehmen, ohne dass es zum gefährlichen Kessler-Syndrom kommt, könnte durch den Klimawandel deutlich kleiner werden. Das haben die Autoren im Fachblatt «Nature Sustainability» erläutert.
Für die beliebtesten Umlaufbahnen für Satelliten in einer Höhe zwischen 400 und 1000 Kilometern erwartet das Team um Parker eine Verringerung der Aufnahmefähigkeit bis zum Jahr 2100 um 33 bis 40 Prozent. Diese Zahl gilt für einen relativ hohen Treibhausgasausstoss – bei wenig ehrgeizigem Klimaschutz auf der globalen Ebene.
«Wenn wir das Risiko des Kessler-Syndroms auf dem gleichen Level halten wollen, sollten wir in Zukunft weniger Müll verursachen», sagt Parker. Die beste Lösung wäre, die Zahl der Satellitenstarts zu begrenzen.
Die Autoren stellen in ihrer Studie auch ein Worst-Case-Szenario vor: Setzt man extrem hohe Treibhausgasemissionen voraus, könnte sich die Aufnahmekapazität der beliebtesten Orbits sogar um bis zu 80 Prozent verringern. So hohe Emissionen wie in diesem Szenario gelten allerdings als unrealistisch.
Laut Thierry Dudok de Wit vom International Space Science Institute in Bern, der nicht an der Studie beteiligt war, wurde das Problem bereits früher studiert. Die neue Arbeit liefere mithilfe eines stark vereinfachten Modells eine erste Abschätzung, wie gross der Effekt sein könnte. In Wirklichkeit seien die Dinge allerdings komplizierter. Zum Beispiel gebe es Satelliten und Weltraumschrott-Trümmer in vielen verschiedenen Grössen, während sie in dem Modell alle gleich gross seien.
Immer mehr Satelliten werden ins All geschossen
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Satelliten geradezu explodiert; sie liegt derzeit bei rund 10 000. Darunter sind allein mehr als 6000 aktive Satelliten des Starlink-Netzwerks von Elon Musk. Für die Zukunft rechnet man mit einem weiterhin starken Wachstum der Satellitenzahl. Bis 2030 könnte es mehr als 100 000 neue im All geben.
Bisher haben sich nur wenige Kollisionen ereignet. Der meiste Weltraummüll stamme von einer Kollision zweier Satelliten im Jahr 2009 und einer gezielten Zerstörung eines Satelliten mithilfe einer chinesischen Rakete im Jahre 2007, sagt Parker.
Wegen der rasanten Vermehrung der Satelliten gibt es mehrere Bestrebungen, die Gefahr des Weltraummülls einzudämmen; zum Beispiel werden immer mehr Ausweichmanöver unternommen. Ausserdem hat man präventive Massnahmen beschlossen.