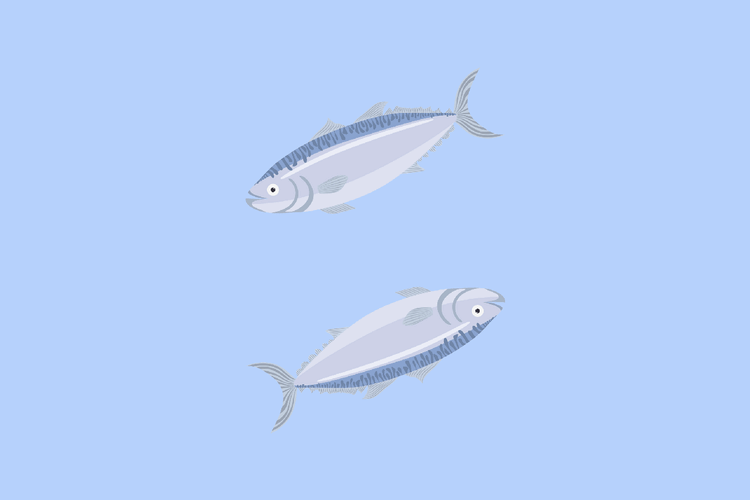24 Knoten, 44 km/h, das Boot kracht auf das flache Wasser. Das Holz knarzt. Die Kompassnadel schlägt von der einen auf die andere Seite. Ein Schluck aus der Kaffeetasse – und der ganze Becher wippt nach oben. Mike Kelly navigiert das Boot an kleinen Inseln vorbei durch die Gewässer des Pazifiks. Er sitzt auf einem hüfthohen Stuhl hinter dem Lenkrad, geschützt vom überdachten Bereich des Bootes, das Gesicht von Schirmmütze und Regenjacke fast verdeckt. Nur die blauen Augen und ein Ansatz des Vollbartes sind zu sehen, wenn er rechts und links nach Schwarzbären, Walen oder Delphinen Ausschau hält.
Kelly fährt so schon seit zwei Jahrzehnten hinaus auf den Pazifik. Im Sommer legt er mit zwanzig anderen Booten im Morgengrauen ab. Kinder, Grosseltern, Mitarbeitende von Firmen sind an Bord. Sie werfen ihre Angeln aus und geniessen die Stille. «Ein magischer Moment mit der Natur» – so erzählt es Kelly, der seit 2003 Angeltouren beim kanadischen Vancouver Island anbietet.
Der 49-Jährige möchte allen zeigen, auf welchem Schatz er lebt. Aber auch, über welchen Schatz demnächst entschieden wird.
Denn Kellys Schatz, die magischen Momente mit der Natur, ist ausgerechnet durch etwas bedroht, was der Natur eigentlich helfen soll: Kanada möchte ein riesiges Netzwerk an Schutzzonen an seiner Westküste errichten. In dem nordamerikanischen Land ist das kein ungewöhnliches Projekt: Während weltweit nur 7 Prozent aller marinen Gewässer geschützt sind, sind es in Kanada laut Regierung 15 Prozent. 2030 soll diese Zahl auf 30 Prozent gesteigert werden – Schleppnetzfischerei, Unterwasserbergbau oder Aktivitäten zur Öl- und Gasgewinnung sollen in den neuen Zonen verboten sein.
Kanada ist eines von über hundert Ländern, die sich dem sogenannten 30×30-Ziel verpflichtet haben: 30 Prozent der Land- und Meeresfläche sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Dieses Ziel nicht nur national, sondern weltweit zu regeln, ist ein grosser Verhandlungspunkt der Uno-Biodiversitätskonferenz, die noch bis 19. Dezember in Montreal stattfindet.
Für Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg-Biodiversität-und-Klima-Forschungszentrums, ist der Schutz von 30 Prozent der Erdfläche sogar das «Minimalziel» der Konferenz – solange es sich auch um gut betreute und vernetzte Gebiete handelt.
Doch die geplanten Gebiete rund um Vancouver Island zeigen, wie schwierig es bereits ist, nationale Gewässer zu schützen. Es ist ein Streit um geplante Regeln, veraltetes Wissen und die Frage nach Mitbestimmung.
Die Regeln
Elf «Rockfish»-Schutzgebiete liegen verteilt um den Norden Vancouver Islands. Die Bezeichnung «rockfish», Felsenfische, umfasst eine ganze Gruppe von Arten, viele davon sind als Speisefisch begehrt. Kelly zeigt die Gebiete auf einer Karte, während das Boot über die Gewässer des Pazifiks schippert, vorbei an Seeottern, die im Wasser treiben, Adlern, die über Inseln fliegen, und Seelöwen, die sich über Felsen wälzen. Ein Schwarm von Möwen umkreist die Raubtiere, während sie mit tiefem Bass über den Ozean brüllen.
«Ich liebe es, anderen Menschen die Natur zu zeigen», erzählt Kelly, der ausgebildeter Biologe ist: «Es geht darum, Informationen zu teilen – über Geologie, Biologie, das Wetter, die Gezeiten.»
Er wolle, dass die Gebiete geschützt seien. Aber schon das Konzept der bisherigen Schutzzonen ergebe für ihn keinen Sinn. In den Felsenfisch-Schutzgebieten zum Beispiel darf er nicht angeln. Schleppnetzfischerei hingegen ist erlaubt, weil sie in grösserer Tiefe stattfindet, wo es keine Felsenfische geben soll. Dabei werden so insgesamt viel mehr Tiere gefangen. Der Angler Kelly hingegen argumentiert, dass er die Fische gar nicht töte, sondern sorgsam wieder ins Wasser lasse.
Die Schutzgebiete für die Felsenfische zählen offiziell nicht einmal zum 30-Prozent-Ziel des Landes. Aber schon sie zeigen, wie schwierig es ist, Regeln für die Schutzgebiete zu finden.
Es ist die Frage, was «Schutz» überhaupt bedeutet, nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt. Laut einer Studie von 2020 waren damals offiziell etwa 6 Prozent des Mittelmeeres geschützt. Doch in 95 Prozent dieser Gebiete herrschen gar keine strengeren Regeln als ausserhalb. Es sind «paper parks», Schutzgebiete nur auf dem Papier.
Die Forschung
Fünf bis zehn Mal, so oft wirft Kelly seine Angel an diesem Tag aus. Dafür stoppt er das Boot, das sich zwischen den Wellen des Ozeans wiegt. Das Getriebe der Angel surrt, als die Schnur über den Ozean gleitet. Sie biegt sich, als ein Fisch anbeisst. Schnell gekurbelt, den Fisch über das Steuerbord, den Haken der Angel entfernt. Der handflächengrosse Barsch zappelt erst wieder, als er zurück in das Wasser gelassen wird.
Kelly könnte an der Westküste Kanadas Forellen, Lachse oder Makrelen fangen, Fische, die teilweise Tausende Kilometer durch den Ozean schwimmen. Wie schützt man ein Gebiet, das keine Grenzen kennt? Wissen wir überhaupt genug über die Meere, deren Tiefen einst als unerforschter als der Mond galten?
Für Kilian Stehfest von der kanadischen David Suzuki Foundation stellt sich die Frage nicht: Natürlich würden Arten wie die Felsenfische am meisten profitieren, da sie eher an einer Stelle verweilten. Aber selbst bei den wandernden Tieren kenne man die Orte, an denen sie geboren würden, essen suchten oder sich paarten. Diese müssten geschützt werden.
Und das eigentlich am besten nicht erst 2030. Denn bis dahin könnte das Wissen über die biologische Vielfalt eines Ortes bereits veraltet sein. «Wenn wir nun etwa feststellen, dass ein Schwammriff besonders wichtig ist», sagt der Biologe: «Wird es in acht Jahren noch da sein?» Vor allem die Schleppnetzfischerei am Grunde des Meeres zerstört die uralten Lebewesen.
Die Kontrolle
Eine Hand am Steuer, die andere am Gas. Kelly fährt wieder in den Hafen seines Heimatortes. Kurz bevor das Schiff den Steg erreicht, wirft er sogenannte Fender auf die eine Seite des Bootes, dicke Zylinder aus Kunststoff, die den Aufprall abfedern. Er schnürt noch das Seil fest, ehe er ein paar Fragen beantwortet.
Da ist die Frage nach der Verantwortung der lokalen Bevölkerung. Nur wenn die betroffenen Anwohner und Nutzer einbezogen werden, lassen sich Regeln durchsetzen. Denn nur wer ein Interesse an einem Gebiet hat, schützt es auch und kontrolliert es zum Beispiel – da sind sich viele Forschende einig.
Ob Kelly sich bei der Planung der neuen Schutzgebiete beteiligt fühlt? «Hier wurde niemand mit eingebunden», sagt er. Die Regierung habe nie Pläne gezeigt, nie erklärt, was in welcher Gegend verboten werden würde: «Es ist, als müssten sie nur Versprechungen an die Vereinten Nationen erfüllen – so und so viel von euren Meeren müsst ihr schützen.»
Die Meereswissenschafterinnen Anna Schuhbauer von der University of British Columbia und Natalie Ban von der University of Victoria hingegen verteidigen den Prozess. Die Regierung habe Treffen zwischen den betroffenen Gruppen organisiert, über den gegenwärtigen Stand informiert und eine Umfrage für Menschen aus der Gegend erstellt.
Allerdings hätten zum Beispiel die Regierung, die Fischerei- und die Tourismusbranche viel mehr Geld als Kleinunternehmer, lokale Fischer oder indigene Gemeinschaften. Sie könnten mehr Nachforschungen anstellen, Lobbyarbeit für ihre Interessen betreiben oder sich besser organisieren.
Doch um die Meere weltweit zu schützen, sind noch zwei weitere Punkte entscheidend. Zum einen, wer die neuen Gebiete finanziert. Die deutsche Forscherin Böhning-Gaese etwa sieht den globalen Norden in der Verantwortung, neue Finanzierungen für Schutzgebiete in ärmeren Ländern zu schaffen. Zum anderen müssen auch Ozeane und Weltmeere mitbedacht werden. Zwar befinden sich die wichtigsten Zonen laut einer Studie in Küstennähe. 60 Prozent der Ozeane aber sind internationale Gewässer. Es gilt auch dieses Gebiet zu schützen, das praktisch allen gehört, aber niemandem so richtig.
Dies alles wird gerade auf der Naturschutzkonferenz verhandelt. Nach ihrem Abschluss wird sich entscheiden, ob die Schutzgebiete nur Zahlen bleiben, die es zu erreichen gilt. Und für Menschen wie Mike Kelly, wie es mit seinem, aber auch vielen anderen Schätzen auf der Welt weitergeht.
Die Recherche für diesen Artikel wurde durch eine Förderung der Heinrich Böll Stiftung Washington möglich gemacht.