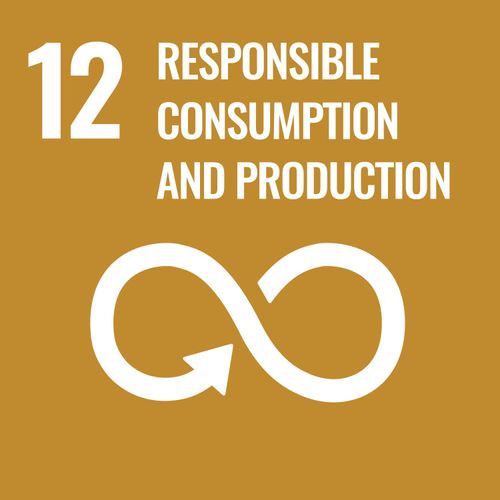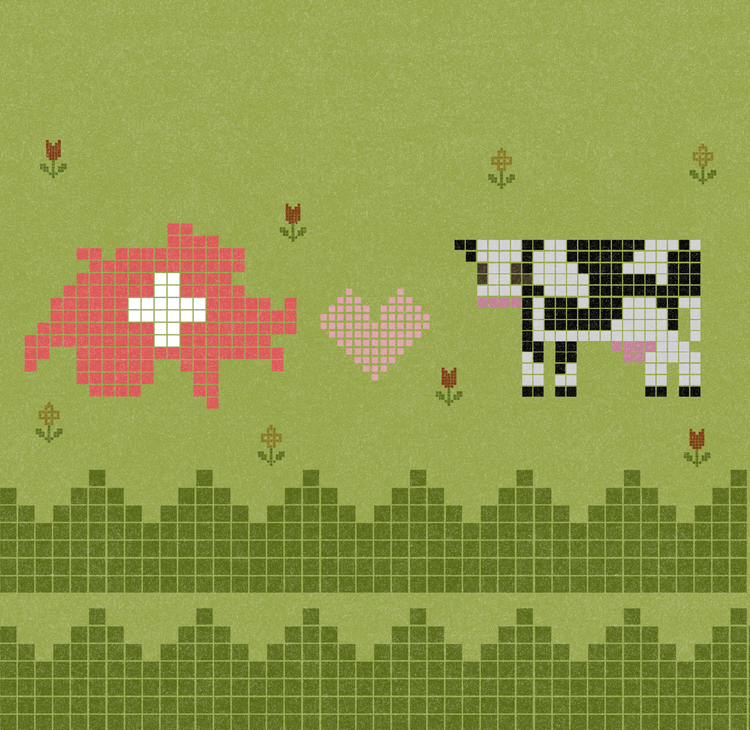Das Image der Kuh hat in letzter Zeit erheblichen Schaden genommen. Weil sie in grossen Mengen Methan ausstösst und auch bei der Futterproduktion Treibhausgase entstehen, gilt sie als Klimasünderin. Nicht nur beim Fleisch, sondern auch bei Milchprodukten wird vermehrt darüber diskutiert, wie klimaschädlich ihr Konsum ist. Und ob ein Umstieg von Kuhmilch auf Hafermilch angezeigt ist.
Wie viele klimaschädliche Gase aufgrund der Milchwirtschaft in die Atmosphäre gelangen, lässt sich in Zahlen fassen: Rund 16 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Schweiz werden durch die Landwirtschaft verursacht – knapp die Hälfte davon geht auf die Milchproduktion zurück. Diesen Ausstoss auf null zu drücken, ist so gut wie unmöglich. «Kühe rülpsen und furzen nun einmal», sagt Christian Hofer, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW).
Doch gibt es Bestrebungen, den CO2-Fussabdruck der Milchwirtschaft zu verringern. «Klimastar Milch» heisst die Initiative – sie ist das umfangreichste und teuerste von insgesamt 34 sogenannten Ressourcenprojekten, mit denen das BLW die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft verbessern will. Rund 16 Millionen Franken Bundesgelder fliessen in das Programm, an dem schweizweit 230 Milchbetriebe teilnehmen.
Lanciert hat das Pilotprojekt allerdings nicht der Bund selbst, sondern mit Nestlé und Emmi zwei der grössten Milchverarbeiter des Landes. Ihr Ziel: Innerhalb von sechs Jahren müssen die beteiligten Bauern ihre Treibhausgasemissionen um 20 Prozent reduzieren.
Die beiden Unternehmen machen sich nicht aus purem Altruismus für mehr Klimaschutz in der Milchwirtschaft stark. Bis 2050 müssen sie die grüne Null erreichen. Und das schaffen sie nur, wenn auch ihre Lieferanten klimafreundlicher produzieren. «Wir glauben an die Zukunft des Rohstoffs Milch», sagt Eugenio Simioni, Chef von Nestlé Schweiz, «aber unsere Kunden und Mitarbeitenden verlangen von uns, dass diese nachhaltiger produziert wird.»
Auf Milch verzichten kann Nestlé nicht. «Einen gleichwertigen Milchersatz auf pflanzlicher Basis wird es in absehbarer Zeit nicht geben», sagt Simioni. Das gelte für die Schokolade ebenso wie für die Babynahrung, bei der die tierischen Proteine nicht kompensiert werden könnten.
Dem Bund jedoch genügt die Reduktion der Treibhausgase allein nicht. Um weitere Ressourcen zu schonen, hat er darauf gepocht, dass das Projekt mit weiteren Zielen kombiniert wird. So sollen die Bauern den Tieren auch weniger Nahrungsmittel verfüttern, die für Menschen ebenso geeignet sind. Zudem sollen möglichst wenige Flächen für den Futteranbau genutzt werden, die für den Anbau von Nahrungsmitteln für den Menschen prädestiniert wären.
«Kühe sind die effizienteste Art, die vielen Wiesen und Weiden in der Schweiz zu nutzen», sagt Hofer. Aber langfristig sei es für die Umwelt besser, wenn die Milchwirtschaft unabhängiger werde vom Ackerfutter.
Kein Kraftfutter mit Soja und Mais
Einer der 230 Bauern, die am Programm teilnehmen, ist Pascal Bühlmann. Bei einer Besichtigung seines Betriebs in Rothenburg (LU) am vergangenen Mittwoch ist sein Stall leer. Bühlmanns Kühe leben auf einem sogenannten Vollweidebetrieb. Das bedeutet, dass sich das Vieh während der Vegetationsperiode von Mitte März bis November fast ausschliesslich vom Gras auf der Weide ernährt.
Um seine Klimabilanz aufzubessern, verzichtet Bühlmann auf Kraftfutter, das Mais oder Soja enthält. Stattdessen setzt er bei der ergänzenden Tierfütterung auf Nebenprodukte, die aus der Verarbeitung von menschlichen Nahrungsmitteln anfallen, so etwa von Schokolade, Rapsöl und Brotgetreide. Zugleich arbeitet der Innerschweizer Landwirt daran, dass seine Kühe über die gesamte Lebenszeit mehr Milch produzieren. Auch damit können die Emissionen pro Liter gesenkt werden. «Wir wollen mit weniger mehr produzieren», sagt der Landwirt.
Schafft Bühlmann die im Projekt vorgegebenen Zielvorgaben, erhält er für die Verkleinerung des CO2-Fussabdrucks eine Prämie von fünf Rappen pro Kilogramm Milch. Die maximale jährliche Abgeltung pro Betrieb beträgt dabei 30 000 Franken.