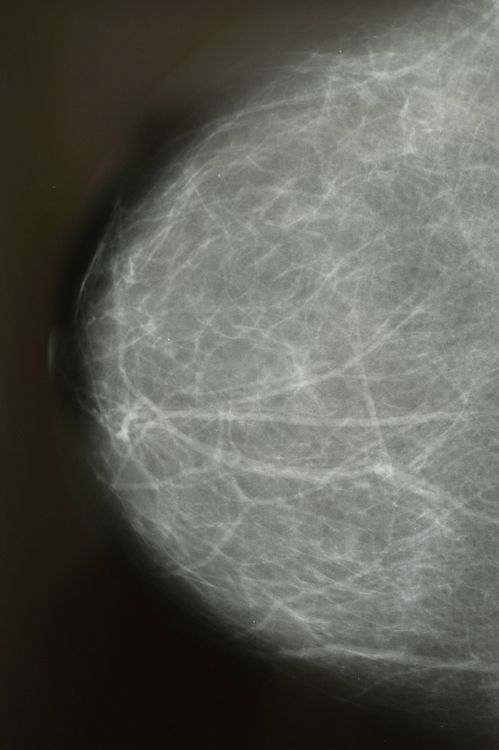Es ist ein eingängiger Slogan, der für ein denkbar einfaches Ideal wirbt: Die personalisierte oder sogenannte Präzisionsmedizin will «für jeden Patienten die richtige Behandlung» finden. Allerdings hinkt die Realität dieser Vision hinterher. Zurzeit gibt es etwa in der Onkologie zwar Behandlungen, die an unterschiedliche Gruppen von Betroffenen angepasst sind. Doch individuell massgeschneiderte Therapien hat die Medizin immer noch nicht zu bieten.
Für viele Krebsbehandlungen ist bekannt, dass nur die Hälfte oder noch weniger aller Patientinnen und Patienten auf die Therapie ansprechen. Zahlreiche Betroffene nehmen also Behandlungen auf sich, ohne dass sie daraus einen Nutzen ziehen. Das lässt sich nicht vermeiden, denn wer von einer Behandlung profitiert und wer nicht, weiss die Ärzteschaft nur sehr selten schon im Voraus.
Das möchte die Forschungsgruppe um Berend Snijder von der ETH Zürich ändern. Sie hat ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Verfahren zur Analyse von biologischen Proben von Krebsbetroffenen entwickelt – und will die Technologie nun mit einem Spin-off-Unternehmen auf den Markt bringen.
Die ersten Versuche, individuelle Unterschiede in der Wirkung von Medikamenten aufzudecken, sind schon über fünfzig Jahre alt. Doch mit den damals verfügbaren Methoden, um Zellen zu kultivieren und zu analysieren, liessen sich nur ungenaue Voraussagen treffen. Insgesamt halfen sie nicht, die Behandlungsresultate zu verbessern.
Die genomische Revolution ist ausgeblieben
Dann wurde, kurz nach der Jahrtausendwende, das gesamte menschliche Erbgut, das sogenannte Genom, entschlüsselt. In der Folge verlor die Präzisionsmedizin ihr Interesse an den Behandlungstests im Labor. Stattdessen konzentrierte sie sich auf die Untersuchung von genetischen Mutationen. Weil solche Veränderungen bei der Bildung von Tumoren eine grosse Rolle spielen, sah vor allem die Krebsmedizin ihre Chance kommen.
Von der genauen Kenntnis dieser Veränderungen erhoffte man sich, neue Schwachstellen zu finden – um den Krebs mit gezielten Medikamenten genau dort angreifen zu können. Tatsächlich seien in der Folge einige auf molekulare Ziele gerichtete Behandlungen entstanden, schreibt der Krebsexperte Anthony Letai in einem Fachbeitrag. Diese Ansätze hätten – etwa bei speziellen Unterarten von Lungen- und Hautkrebs – zwar zu «mehreren echten klinischen Erfolgen» geführt, doch bis heute profitiere insgesamt nur eine kleine Minderheit der Krebspatienten vom Wissen um die Fehler im Erbgut.
Die genomische Revolution ist bisher also ausgeblieben. Doch nun besinnt sich die Präzisionsmedizin wieder auf den alten Hoffnungsträger. Denn im Feld der Behandlungstests im Labor hat es deutliche Fortschritte gegeben: Die Methoden zur Züchtung von Zellen und zu deren mikroskopischer Analyse haben sich stark verbessert.
Das schaffe eine neue Ausgangslage, argumentiert Letai. Tatsächlich gewinnt die Analyse von Patientenzellen in der personalisierten Medizin zusehends an Bedeutung. Wie eine kürzlich veröffentlichte Übersicht darlegt, erforschen allein im Krebsbereich gegenwärtig achtzehn klinische Studien verschiedene Ansätze.
Ein Algorithmus, der die Form von Zellen erkennt
Besonders weit fortgeschritten ist der Ansatz, den das Team um Berend Snijder schon seit zehn Jahren entwickelt. Snijder nennt das Verfahren Pharmakoskopie: ein Kunstwort, das die beiden Begriffe Pharmazeutika, also Wirkstoffe, und Mikroskopie verbindet. «Wir schauen uns unter dem Mikroskop an, was Medikamente machen», sagt der Systembiologe. Doch das «wir» stimmt genaugenommen nicht mehr ganz: Heute werden die Mikroskopie-Bilder automatisiert ausgewertet.
Das war nicht immer so. Zuerst musste das Team eigenhändig Millionen von Zellen auf den Bildern vermessen und in maschinenlesbarer Sprache beschriften. «Damit haben wir sehr viel Zeit verbracht», sagt Snijder. So haben die Forschenden einem Algorithmus beigebracht, die Form und die Grösse von Zellen zu erkennen. Heute kann der Algorithmus von selbst zum Beispiel gesunde von entarteten Zellen unterscheiden – und für jede einzelne Zelle messen, wie stark ihr eine Behandlung zusetzt.
Die Nützlichkeit ihres Ansatzes haben die Forschenden zuerst bei Patientinnen und Patienten mit aggressiven Formen von Blutkrebs unter Beweis gestellt. In Blutproben von wenigen Millilitern stecken Millionen von Zellen. Deshalb genügen winzige Tröpfchen von Blut, um zu messen, wie empfindlich die Zellen auf Medikamente reagieren. Die Tröpfchen verteilt das Team um Snijder auf Hunderte von kleinen Vertiefungen in Plastikbehältern. So kann es rasch eine Vielzahl von Behandlungen miteinander vergleichen.
Dann gilt es, die Zellen mit biochemischen Methoden zu färben – und die Plastikbehälter in eine Maschine zu schieben, die von jeder Vertiefung ein hochaufgelöstes Mikroskopie-Bild aufnimmt. «Zellen abzutöten, ist einfach: Dafür genügt eigentlich ein bisschen Seife», sagt Snijder. «Aber wir suchen Substanzen, die vor allem Krebszellen zerstören – und dabei die gesunden Zellen möglichst intakt lassen.» Der Algorithmus untersucht für jede erkrankte Person Tausende von Bildern. Am Schluss erstellt er eine Rangliste von Medikamenten: An der Spitze stehen die Wirkstoffe, die wesentlich mehr Krebszellen als gesunde Zellen abtöten.